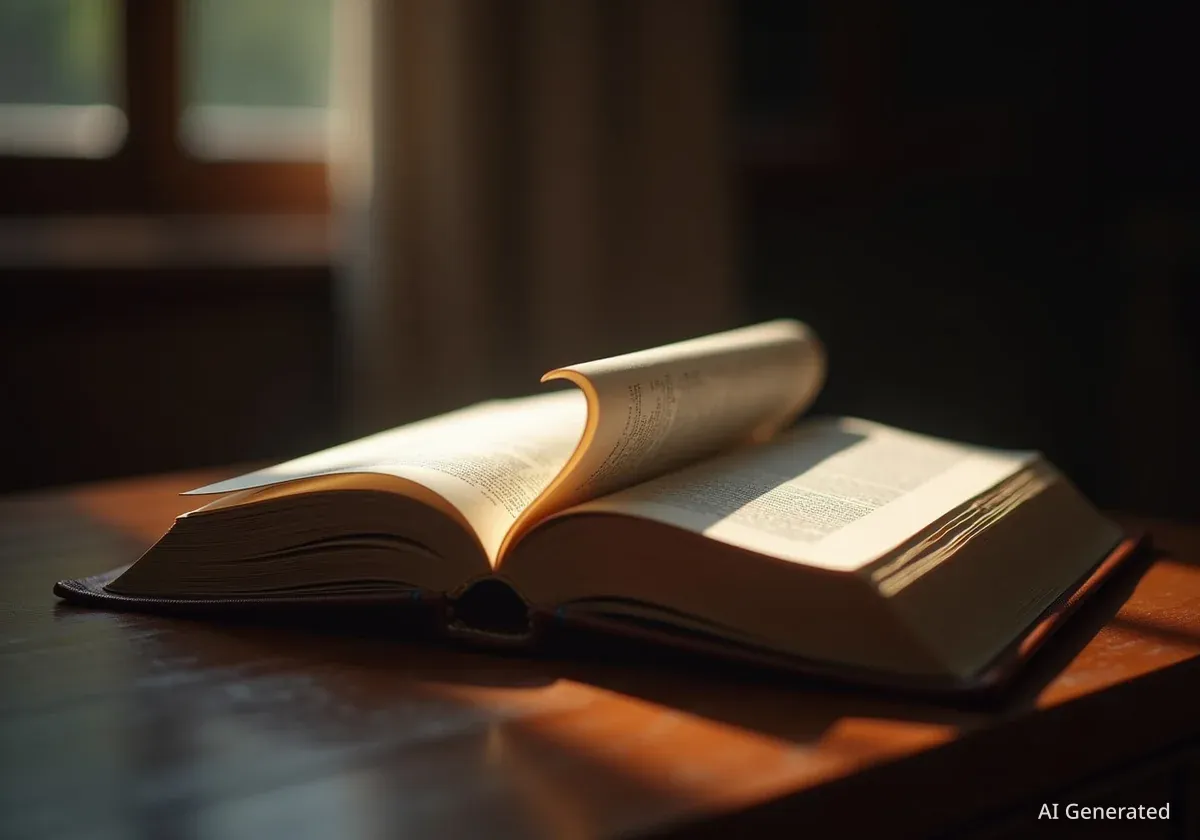Die Sprengung des alten Stadttheaters Basel im Jahr 1975 und der anschliessende Bezug des Neubaus markierten einen tiefgreifenden Wandel. Cathérine Miville, damals selbst am Theater tätig, erlebte diesen Prozess hautnah mit. Ihre anfängliche Skepsis gegenüber dem modernen "Betonklotz" wich im Laufe der Zeit einer neuen Faszination für die Möglichkeiten, die das neue Haus bot.
Wichtige Erkenntnisse
- Das alte Stadttheater Basel genügte den Anforderungen des 20. Jahrhunderts nicht mehr.
- Ein Referendum gegen den Abriss des alten Gebäudes scheiterte.
- Der Neubau führte zu einem Direktorenrücktritt und anfänglichem Chaos.
- Trotz anfänglicher Skepsis entwickelte sich eine neue Unternehmenskultur.
- Die Eröffnung des neuen Hauses war ein grosser Erfolg mit 15'000 Besuchern.
Das alte Theater: Eine verpasste Chance
Das erste Basler Stadttheater brannte 1904 vollständig nieder. Der Neubau von 1906 war jedoch, wie Karl Gotthilf Kachler in seiner "Entstehungsgeschichte des neuen Basler Stadttheaters" beschreibt, eine Kopie des Originals. Er basierte auf der Technik von 1875 und war für Theaterformen des 19. Jahrhunderts konzipiert. Sogar die Theaterkasse wurde erneut vergessen. Ein Referendum, das ein "Volkstheater" statt eines "Herrentheaters" forderte, scheiterte.
Faktencheck
- 1904: Das erste Basler Stadttheater brennt vollständig ab.
- 1906: Zweites Stadttheater wird als Kopie des ersten gebaut.
- 1967: Entscheidung für den Abriss des Johann-Jakob-Stehlin-Baus.
- 1973: Geplante Eröffnung des dritten Stadttheaters.
- 1975: Sprengung des alten Stadttheaters.
Die Mitarbeiter des Theaters wussten, dass das alte Haus in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Anforderungen eines modernen Theaterbetriebs entsprach. Der Brandschutz war unzureichend. Trotzdem empfanden viele, einschliesslich Cathérine Miville, den geplanten Neubau als "Betonklotz". Sie befürchteten den Verlust des geliebten alten Hauses.
Ein chaotischer Übergang zum Neubau
Als der Neubau konkreter wurde, traten die ersten Probleme auf. Es fehlten die finanziellen Mittel, um die höheren Betriebskosten auszugleichen. Theaterdirektor Werner Düggelin trat daraufhin zurück. Dies geschah trotz grosser Sympathiebekundungen aus dem Haus und der gesamten Stadtgesellschaft.
"Meine emotionale Ablehnung des Neubaus wuchs, da durch den Betonklotz 'unser' Theaterdirektor hinwarf – der Mann, der das Theater für junge Menschen nicht nur geöffnet, sondern gemeinsam mit einem kongenialen Team von Theatermacher*innen auch in hohem Masse formal, inhaltlich und ästhetisch attraktiv gemacht hatte."
Düggelin hatte das Theater für junge Menschen geöffnet und es mit einem Team von Theatermachern attraktiv gemacht. Sein Rücktritt verstärkte die Ablehnung vieler gegenüber dem neuen Gebäude. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig und chaotisch. Erst am 20. Dezember 1974 wurde Hans Hollmann zum neuen Direktor gewählt, kurz vor der geplanten Eröffnung des neuen Hauses.
Die Sprengung und neue Perspektiven
Die Stadt lehnte 1973 die Weiternutzung des alten Theaters als Kulturzentrum ab. Ein Referendum für den Erhalt des alten Hauses scheiterte ebenfalls. Am 6. August 1975 um fünf Uhr morgens wurde das alte Stadttheater gesprengt. Cathérine Miville war Zeugin dieses Ereignisses.
Hintergrundinformationen
Cathérine Miville, geboren und aufgewachsen in Basel, begann ihre Karriere am Theater Basel. Später führte sie in Deutschland Regie und war Intendantin des Stadttheaters Giessen. Nach dem Tod ihres Vaters, des Basler SP-Alt-Ständerats Carl Miville-Seiler, kehrte sie nach Basel zurück. Ihre Kolumne "Ma ville" beleuchtet das kulturelle Leben der Stadt.
Innerhalb von wenigen Momenten fiel das Gebäude in sich zusammen. Es entstand eine gigantische Staubwolke. Dieser Moment war für viele, die das alte Haus kannten, sehr emotional. Die Unumkehrbarkeit des Vorgangs war spürbar. Die Basler Regierung setzte die normative Kraft des Faktischen durch, obwohl ein Entscheid des Bundesgerichts noch ausstand.
Eine neue Unternehmenskultur entsteht
In den Wochen nach der Sprengung wurde deutlich: Mit dem Neubau würde auch eine neue Unternehmenskultur im "Theater Basel" entstehen. Miville erkannte, dass Werner Düggelin zu Recht zurückgetreten war. Die Art und Weise, wie er das alte Haus geleitet hatte, war im neuen Gebäude nicht mehr möglich.
Ein Beispiel hierfür war die Kommunikation. Im Altbau dienten kleine Zimmer mit Durchgangstüren als Büros. Dies ermöglichte eine offene Kommunikation. Im Neubau gab es Zimmer Tür an Tür in langen Fluren auf verschiedenen Etagen. Vorgänge mussten verschriftlicht werden. Die Kommunikation lief über ein neu eingeführtes System von farbigen Lauf-Mäppchen.
Professionelle Strukturen für künstlerische Arbeit
Diese professionellen Formen der betrieblichen Organisation waren für die Mitarbeiter ein Kulturschock. Viele waren überzeugt, dass so keine Kunst entstehen könne. Doch Miville weiss heute: Solide Strukturen ermöglichen künstlerische Zusammenarbeit. Wichtig sind dabei Prozesse, die auf Vertrauen und Respekt basieren und alle Beteiligten einbeziehen.
Trotz der anfänglichen Herausforderungen wurde die Eröffnung des neuen Hauses ein Erfolg. Innerhalb von neun Monaten organisierte das Team einen dreitägigen Theatermarkt. 15'000 Besucher kamen. Hans Hollmann formulierte das Motto bescheiden: "So wurde noch nie ein Theater eröffnet." Das gesamte Haus zog mit. Wenige Tage später wurde die Premiere der ersten Opernaufführung im neuen Haus gefeiert.
Diese Zeit prägte Cathérine Miville als Berufsanfängerin stark. Sie lernte, konstruktiv mit Vorurteilen umzugehen, sei es gegenüber Theaterbauten, Organisationsformen oder neuen Ideen. Die Auseinandersetzungen im und um das Theater lehrten sie die Notwendigkeit, wirtschaftliche und strukturelle Zusammenhänge für nachhaltig erfolgreiche künstlerische Arbeit zu verstehen. Ihre späteren Erfolge in der Theaterleitung führt sie massgeblich auf diese "wilden Theaterjahre" der frühen Siebziger in Basel zurück.