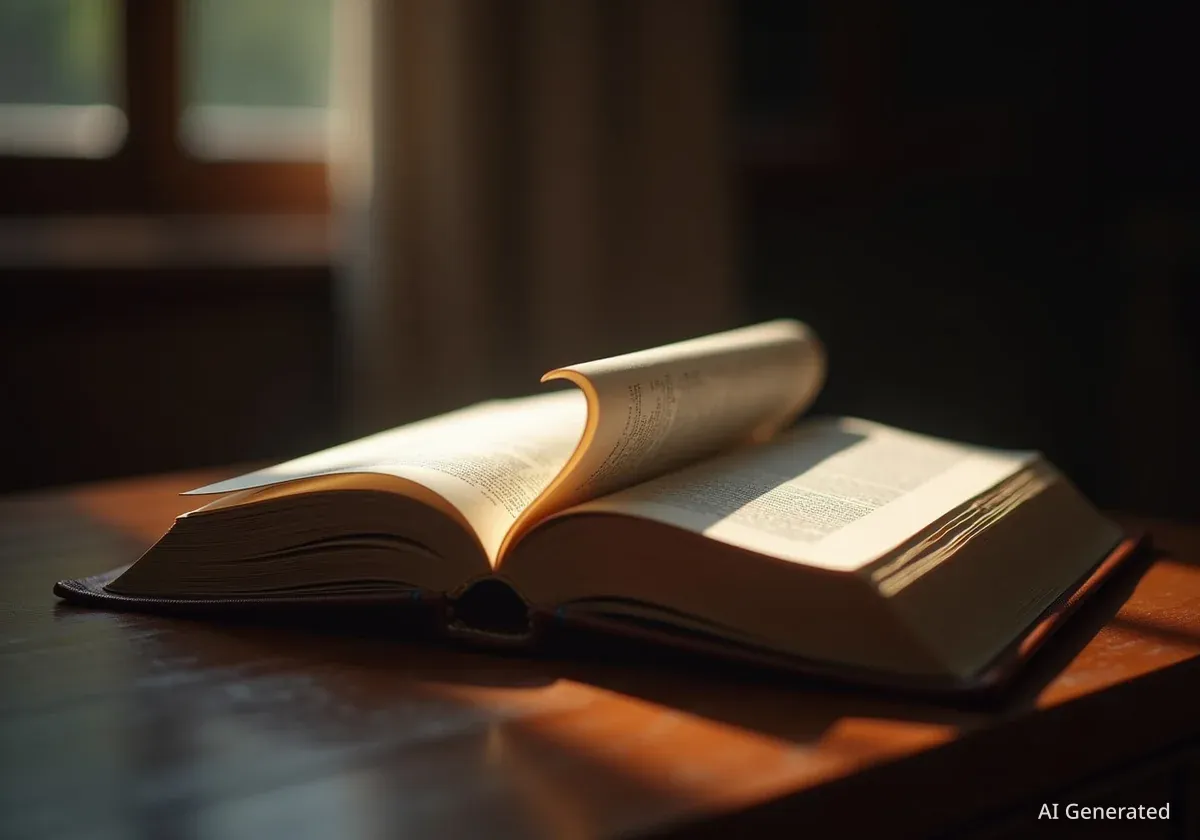Die menschliche Faszination für Geister ist tief verwurzelt. Eine aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Basel beleuchtet die Entwicklung des Übernatürlichen. Sie zeigt, wie sich die Wahrnehmung von Geistern im Laufe der Geschichte verändert hat und warum sie uns auch heute noch beschäftigen.
Von furchterregenden Erscheinungen bis zu niedlichen Popkultur-Ikonen: Geister spiegeln unsere Ängste und Hoffnungen wider. Die Schau untersucht, wie wir mit dem Unerklärlichen umgehen und welche Rolle Kunst und Wissenschaft dabei spielen.
Wichtige Erkenntnisse
- Geister haben sich von furchterregenden Wesen zu Popkultur-Phänomenen entwickelt.
- Die älteste bekannte Geistergeschichte ist 3500 Jahre alt und stammt aus Babylon.
- Im 19. Jahrhundert versuchten Wissenschaftler, Geister mit Fotografie zu beweisen.
- Die moderne Gesellschaft neigt dazu, Unerklärliches zu verdrängen oder rational zu erklären.
- Die Ausstellung im Kunstmuseum Basel zeigt Werke aus über 250 Jahren.
Die Entwicklung der Geistervorstellung
Geister erscheinen oft in einem simplen weissen Laken. Diese Darstellung hat eine historische Bedeutung. Ursprünglich war das weisse Laken ein Leichentuch. Bis ins 18. Jahrhundert waren Geister keine süssen Figuren. Sie galten als furchterregende Erscheinungen.
Diese "schröcklichen Gespengster" suchten nachts häufig Kreuzwege oder frühere Wohnorte heim. Oft waren es Geister von Ermordeten, die zurückkehrten. Sie blieben, bis ihre Taten aufgeklärt wurden. Ein bekanntes Beispiel ist der Geist von Hamlets Vater in Shakespeares Drama.
Faktencheck
- Älteste Geschichte: Die älteste bekannte Geistergeschichte findet sich auf einer 3500 Jahre alten babylonischen Tafel.
- Kulturelle Präsenz: Geisterwesen wie die "Weisse Frau" oder "Banshee" tauchen in vielen Kulturen weltweit auf.
Im 20. Jahrhundert begann sich das Bild der Geister zu wandeln. Sie wurden zunehmend "süss" und kinderfreundlicher dargestellt. Ein wichtiger Impuls kam aus der Popkultur.
Der Film "Ghostbusters" aus dem Jahr 1984 spielte dabei eine Pionierrolle. Figuren wie der "Stay Puft Marshmallow Man" und die Darstellung von Geisterjägern durch Schauspieler wie Bill Murray prägten ein neues, zugänglicheres Bild von Geistern. Dies führte zu einer breiteren Akzeptanz in der Unterhaltung.
Geister in der zeitgenössischen Kunst
Die Ausstellung "Geister" im Kunstmuseum Basel zeigt, wie zeitgenössische Künstler das Thema aufgreifen. Ein Beispiel ist die US-amerikanische Künstlerin Angela Deane. Sie malt herzige Gespenster auf alte, vergilbte Fotos. Die Menschen auf diesen Fotos sind oft längst verschwunden oder vergessen.
Deanes Werk scheint vordergründig süss. Es behandelt jedoch tiefe Themen wie Tod und Vergessenheit. Die süssen Geister maskieren diese existentiellen Realitäten. Dies ist eine Form des Verdrängens, die im 21. Jahrhundert oft zu beobachten ist.
"Wo sind denn all die Toten? Wo geht ihre Lebensenergie hin?", fragt Kuratorin Eva Reifert. "Die Frage nach den Toten ist zwar uralt, braucht aber heute eine gute Portion Mut."
Im ersten Raum der Ausstellung leuchtet eine Neon-Schrift der irischen Künstlerin Susan MacWilliam. Sie fragt: "Where are the dead?" Eine direkte Antwort bleibt aus. Dies unterstreicht die zentrale Erkenntnis der Ausstellung: Die moderne Gesellschaft tut sich schwer mit dem Unerklärlichen.
Hintergrund: Die Ausstellung "Geister" in Basel
Die Ausstellung "Geister. Dem Übernatürlichen auf der Spur" im Kunstmuseum Basel präsentiert eine Vielzahl von Werken und Objekten. Sie stammen aus über 250 Jahren. Zu sehen sind:
- Geisterjägerkästen und Fotos aus dem 19. Jahrhundert
- Ein Brief von Thomas Mann
- Zahlreiche zeitgenössische Kunstwerke
Der Umgang mit Spuk im 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert war der Geisterglaube weniger verdächtig als heute. Die Menschen waren offener für paranormale Phänomene. Technische Erfindungen beflügelten die Hoffnung, auch Geister wissenschaftlich nachweisen zu können.
Kuratorin Eva Reifert erklärt: "Eben war die Telegrafie erfunden worden, das Telefon und die Tonbandaufzeichnung. Warum also sollte man nicht auch mit Toten reden können?" Diese Denkweise führte zu zahlreichen Experimenten und auch zu Betrugsfällen.
Fotografie als Geisterbeweis
Die damals junge Technik der Fotografie spielte eine Schlüsselrolle. Viele Wissenschaftler und Betrüger versuchten, Geister abzulichten. Einer von ihnen war der Parapsychologe Albert Freiherr von Schrenck-Notzing, bekannt als "Geisterbaron". Er veranstaltete Séancen.
Bei diesen Séancen wurden unerklärliche Ereignisse fotografisch festgehalten. Fotos zeigten weisse Substanzen aus dem Mund eines Mediums, Materie, die aus Köpfen wuchs, oder Blitze. Diese Darstellungen wirkten höchst bizarr.
Der Schriftsteller Thomas Mann besuchte eine solche Séance. Er berichtete über seine Erfahrungen: "Das war nicht möglich – aber es geschah. Der Blitz soll mich treffen, wenn ich lüge." Dies zeigt, wie stark der Glaube an solche Phänomene war.
Geisterfotografie
Bei der "Geisterfotografie" liessen sich Hinterbliebene fotografieren. Hinter ihnen erschien der tote Ehepartner als schemenhafter Geist. Dieses Geschäft florierte. Es gab den Menschen die Illusion, dass ihre Verstorbenen noch "da" waren. Erst aufsehenerregende Prozesse deckten die Betrügereien der international tätigen Fotografen auf.
Moderne Perspektiven auf das Unerklärliche
Im 21. Jahrhundert wird Unerklärliches oft rationalisiert oder verdrängt. Spukphänomene haben in einem auf Rationalität und Effizienz ausgerichteten Weltbild kaum Platz. Sie werden oft als Halluzinationen abgetan.
Trotzdem gibt es viele Menschen, die unerklärliche Erfahrungen machen. Viele Kulturen gehen selbstverständlich von der Existenz von Geistern aus. Kuratorin Reifert bemerkt dazu spöttisch: "Man könnte auch sagen, nur wir Europäerinnen und US-Amerikaner stellen uns bei dem Thema etwas schwierig an."
Der renommierte britische Assyriologe Irving Finkel schreibt im Vorwort des Basler Ausstellungskatalogs: "Menschen, die einem, wenn sie nur wollten, das eine oder andere über Geister erzählen könnten, fürchten Spott und Hohn." Dies verdeutlicht die gesellschaftliche Scheu, über solche Themen zu sprechen.
Spukhäuser und Erzählungen
Die US-amerikanische Künstlerin Corinne Botz hat sich diesem Thema unvoreingenommen genähert. Für ihr Projekt "Haunted Houses" besuchte sie zehn Jahre lang 100 angebliche Spukhäuser. Sie sammelte die Geschichten der Bewohner.
Botz dokumentierte die Orte und die Erlebnisse der Menschen. Sie hörte von fliegenden Teetassen, sich mysteriös schliessenden Türen und freundlichen Wesen. Diese Wesen ähnelten eher Mitbewohnern als klassischen Gespenstern.
Die Künstlerin war nicht an der Frage interessiert, ob Geister wirklich existieren. Ihr Fokus lag auf den Erzählungen der Menschen. Ihre Fotoserie erforscht das Unheimliche. Sie stellt die Frage: Entsteht das Gruselige im Haus oder in unseren Köpfen?
Diese Herangehensweise zeigt eine wichtige Einsicht: Mutig ist nicht, wer Geister mit Kameras jagt. Mutig ist, als Skeptikerin alle Zweifel auszuhalten. Mutig ist es, den Geistergeschichten anderer einfach zuzuhören. Dies öffnet den Raum für menschliche Erfahrungen jenseits der reinen Rationalität.