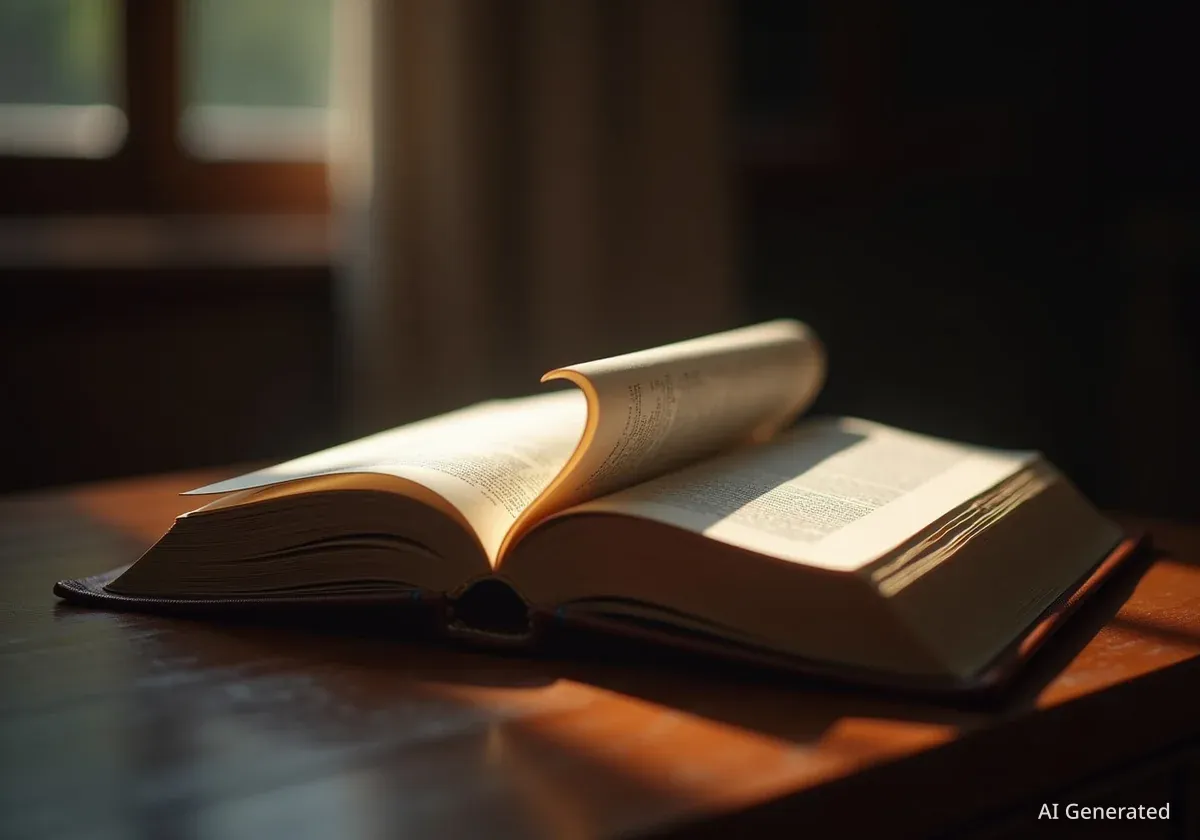Über 3000 Baslerinnen und Basler haben ihre Träume mit dem Museum der Kulturen Basel geteilt. Die gesammelten Zeichnungen und Beschreibungen offenbaren, wie ähnlich die nächtlichen Erlebnisse der Menschen sind. Häufige Motive reichen von fantastischen Kreaturen bis zu klassischen Stresssituationen.
Wichtige Erkenntnisse
- Mehr als 3000 Personen haben ihre Träume im Museum der Kulturen Basel dokumentiert.
- Fabelwesen und Ungeheuer sind häufige Traummotive, besonders der Wolf.
- Klassische Traumszenarien wie Fallen, Prüfungssituationen und Verspätungen treten oft auf.
- Träume sind Reaktivierungen von Erlebnissen, die das Gehirn nachts verarbeitet.
- Die Ähnlichkeit der Träume deutet auf gemeinsame emotionale Verarbeitungsprozesse hin.
Das Traumarachiv des Museums der Kulturen
Zwischen April 2023 und Januar 2025 bot das Museum der Kulturen Basel Menschen die Möglichkeit, ihre Träume zu teilen. Über 3000 Personen nutzten diese Gelegenheit. Sie hielten ihre nächtlichen Erlebnisse in Zeichnungen und schriftlichen Beschreibungen fest. Diese Sammlung bietet einen einzigartigen Einblick in das Unterbewusstsein der Basler Bevölkerung.
Die Auswertung der Beiträge zeigt eine überraschende Ähnlichkeit der Trauminhalte. Viele Menschen erleben im Schlaf ähnliche Gefühle und Situationen. Dies deutet darauf hin, dass unser Gehirn auf universelle Weisen Emotionen und Erlebnisse verarbeitet.
Faktencheck: Traumhäufigkeit
Eine deutsche Studie aus dem Jahr 2004 zeigte: Über 60 Prozent der Befragten träumen vom Fallen. Dies ist ein sehr verbreitetes Motiv, das auch in den Basler Beiträgen oft vorkommt.
Fantasiewesen und kindliche Albträume
Ein signifikanter Anteil der gesammelten Träume handelt von Fabelwesen und Ungeheuern. Besonders Kinder teilten drastische und fantasievolle Erlebnisse. Ein Kind schrieb: „Meine Mama wurde von einem Fantasietier gefresen.“ Ein anderes notierte einen Traum, in dem Basel von Dinosauriern überfallen wurde und Menschen getötet und gefressen wurden.
Nicht alle Fantasieträume sind negativ. Manche Beiträge beschreiben auch positive oder magische Transformationen. Ein Kind zeichnete sich selbst als Einhorn. Eine andere Person berichtete von einem wiederkehrenden Traum über eine Lichtung mit Dinosauriern, die eine friedliche Atmosphäre ausstrahlte.
Begegnungen mit dem Wolf
Der Wolf erscheint in den Träumen der Baslerinnen und Basler mehrfach als Motiv. Eine Zeichnung zeigt einen Wolf, der durch einen Türspalt blickt. Die dazugehörige Beschreibung lautet:
„Er starrt mich an. Ich will schreien und weglaufen, kann es aber nicht. Dann wache ich auf.“
Solche intensiven, oft beängstigenden Begegnungen im Traum sind ein wiederkehrendes Thema. Sie spiegeln möglicherweise unbewusste Ängste oder Gefühle der Hilflosigkeit wider.
Klassische Traummotive der Basler
Neben Fantasiewesen finden sich viele klassische Traummotive in der Basler Sammlung. Diese sind oft mit Stress oder dem Gefühl des Kontrollverlusts verbunden. Zu den häufigsten Beispielen gehören:
- Fallen und Fliegen: Viele Menschen träumen davon, von einer Höhe zu stürzen. Eine Person aus Basel schrieb: „Ich bin von der Mittleren Brücke gefallen.“ Eine andere berichtet von regelmässigen Träumen, in denen sie mit dem Auto von einer Klippe stürzt. Dabei erinnert sie sich kurioserweise, im Fall immer die Fenster zu öffnen.
- Verspätungen: Das Verpassen eines Zuges oder das späte Erreichen eines Termins sind ebenfalls verbreitete Szenarien. Manchmal sind diese Träume mit unangenehmen Konsequenzen verbunden.
- Prüfungssituationen: Viele träumen davon, eine Prüfung nicht zu bestehen oder unvorbereitet zu sein.
- Verlust: Der Traum, eine nahestehende Person zu verlieren, gehört ebenfalls zu den weit verbreiteten Motiven.
Hintergrund: Warum wir träumen
Psychologin und Schlafforscherin Christine Blume vom Zentrum für Chronobiologie und der Schlafambulanz der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) erklärt: „Man geht davon aus, dass es ein Wach-Traum-Kontinuum gibt und sich daher der Alltag in unseren Träumen wiederfindet.“ Das Gehirn ist nachts sehr aktiv und verarbeitet Eindrücke und Emotionen. Träume sind oft eine Reaktivierung von Erlebnissen, die zu einer Art „Storyline“ verknüpft werden.
Die Rolle der Träume bei der Emotionsverarbeitung
Träume sind demnach keine zufälligen Hirnaktivitäten. Sie dienen dazu, Emotionen und Erlebnisse des Tages zu verarbeiten. Wenn jemand von der Schule träumt, obwohl er schon lange nicht mehr zur Schule geht, kann das Gehirn eine andere Art von Prüfungssituation im Leben verarbeiten, beispielsweise ein bevorstehendes Jobinterview.
Manchmal spiegeln sich auch kollektive Erfahrungen in Träumen wider. Während der COVID-19-Pandemie träumten viele Menschen von Viren, Masken und Schutzanzügen. Dies führte zum Begriff „Corona Dreams“ in den sozialen Medien. Solche Phänomene zeigen, wie stark unser kollektives Bewusstsein und unsere Ängste unsere Traumwelt beeinflussen können.
Christine Blume betont, dass Träume zwar keine Orakel sind, aber wichtige Hinweise auf unsere innere Verfassung geben können. „Wenn mir ein Patient sagt, ein Traum komme immer wieder und beschäftige ihn, dann ist das oft ein guter Ausgangspunkt für ein Gespräch“, so die Expertin. Träume bleiben Expeditionen unseres Gehirns, die uns helfen, den Alltag zu verarbeiten und zu verstehen.
Die Sammlung des Museums der Kulturen Basel bietet somit nicht nur einen faszinierenden Einblick in die Traumwelt einer Stadt. Sie liefert auch wertvolle Daten für die Schlafforschung und Psychologie. Die Ähnlichkeit der Träume unterstreicht, wie tief menschliche Erfahrungen und Emotionen miteinander verbunden sind.
Die Dokumentation der Träume zeigt, dass unser Unterbewusstsein komplexe Geschichten erzählt. Diese Geschichten sind oft universell. Sie verbinden uns auf einer Ebene, die über individuelle Erfahrungen hinausgeht.