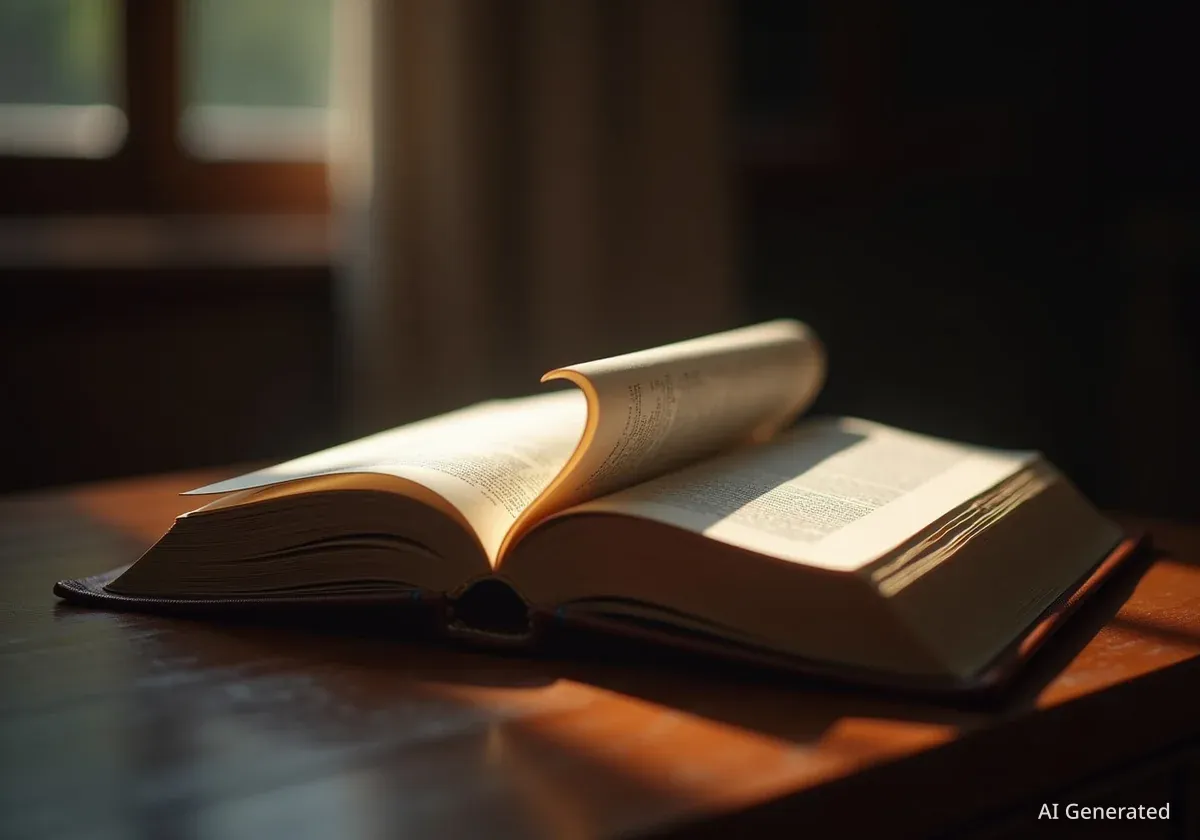Das Theater Basel präsentiert die Schweizer Erstaufführung des Balletts «Der Liebhaber» von Marco Goecke. Die Inszenierung basiert auf Marguerite Duras' erfolgreichem Roman und zeichnet ein getanztes Psychogramm. Das neu formierte Ensemble des Ballett Basel zeigte am Samstagabend eine kraftvolle Leistung, wobei die Dringlichkeit der zugrunde liegenden Geschichte stellenweise in den Hintergrund trat.
Wichtige Punkte
- Das Ballett «Der Liebhaber» feierte am Theater Basel Schweizer Erstaufführung.
- Choreograf Marco Goecke, bekannt für seinen einzigartigen Stil, leitet das neu formierte Ballett Basel.
- Die Inszenierung adaptiert Marguerite Duras' autobiografischen Roman über eine verbotene Liebe im kolonialen Indochina.
- Das Ensemble überzeugte mit ausdrucksstarken Darbietungen, insbesondere in der Darstellung komplexer Familienbeziehungen.
- Kritiker bemerken eine teilweise Verflüchtigung der dramatischen Tiefe der Romanvorlage.
Eine getanzte Erzählung: Die Geschichte des Mädchens und des Liebhabers
Die Inszenierung beginnt mit dem Mädchen, dargestellt von Sandra Bourdais, das wie eine flüchtige Traumgestalt über die Bühne huscht. Ihre erste Begegnung mit dem Liebhaber, verkörpert von Maurus Gauthier, erfolgt erst spät im Stück. Ihre Annäherung ist geprägt von Distanz und Sehnsucht: Sie umkreisen einander, bewegen sich im Gleichschritt und strecken sich nacheinander aus, ohne sich physisch zu berühren. Diese getanzte Darstellung des Begehrens bildet das Herzstück des Handlungsballetts. Ein charakteristischer Männerhut, den das Mädchen im Roman trägt, bleibt im Bühnenbild liegen und erzeugt eine optische Täuschung, als würde er im Wasser davonschwimmen.
Faktencheck
- Romanvorlage: Marguerite Duras' «Der Liebhaber» (1984) ist ein autobiografischer Roman, der in der französischen Kolonialzeit in Indochina spielt.
- Erfolgsgeschichte: Das Buch wurde zu einem der grössten Verkaufserfolge der französischen Nachkriegsliteratur.
- Verfilmung: Der Roman wurde 1992 von Jean-Jacques Annaud verfilmt, was seine internationale Bekanntheit weiter steigerte.
Duras' autobiografische Wurzeln und die dysfunktionale Familie
Marguerite Duras (1914–1996) verarbeitete in «Der Liebhaber» ihre eigene Kindheit und Jugend im ehemaligen Französisch-Indochina, dem heutigen Vietnam. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, nachdem ihr Vater früh verstorben war. Ihre Mutter zog sie und ihre beiden Brüder alleine auf. Duras beschrieb ihre Kindheit als „wild“. Diese Erfahrungen spiegelten sich auch in ihrem früheren Roman «Heisse Küste» (1950) wider. Beide Werke thematisieren eine leidenschaftliche Beziehung zwischen einer minderjährigen weissen Frau aus armen Verhältnissen und einem reichen asiatischen Mann. Die Autorin schilderte zudem ihr klaustrophobisches Zuhause, geprägt von einer „verrückten“ Mutter, einem gewalttätigen älteren Bruder und einem jung verstorbenen jüngeren Bruder. Diese dysfunktionale Familiendynamik bildet einen zentralen Aspekt der Geschichte.
Marco Goecke: Ein umstrittener Künstler in Basel
Marco Goecke, der neue künstlerische Leiter des Ballett Basel, und sein neu formiertes Ensemble ernteten am Ende der Premiere tosenden Applaus. Mit Goecke hat das Theater Basel einen Choreografen von Weltrang verpflichtet, der jedoch auch eine umstrittene Persönlichkeit ist. Im Jahr 2023 sorgte Goecke für einen internationalen Skandal. Nach einer kritischen Rezension zu seinem Stück «Glaube – Liebe – Hoffnung» durch eine Journalistin der Frankfurter Allgemeine Zeitung, beschmierte er diese im Foyer der Staatsoper Hannover mit Hundekot. Dies führte zu seiner umgehenden Kündigung. Am Theater Basel erhält er nun eine zweite Chance, die von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt wird.
Hintergrundinformationen
Die Schweizer Erstaufführung von «Der Liebhaber» wurde ursprünglich 2021 am Staatsballett Hannover uraufgeführt. Die Wahl dieses Stücks für Goeckes Einstand in Basel unterstreicht die künstlerische Linie des Theaters, auch kontroversen Persönlichkeiten eine Plattform zu bieten. Die Produktion in Basel ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Inszenierung, die Goeckes charakteristischen Stil auf die Bühne bringt.
Bühnenbild und Musik: Eine fliessende Welt
Die Tänzerinnen und Tänzer sind in minimalistischer, androgyner Kleidung zu sehen. Die Kolonialzeit der 1930er-Jahre wird nicht explizit dargestellt, sondern entsteht eher in der Vorstellung des Publikums. Ein Hauch von Opiumnebel durchzieht die Bühne, wenn eine dampfende Figur die Atmosphäre verdichtet. Der Fluss spielt eine zentrale Rolle im Bühnenbild, gestaltet als Rampe, die zum Tanzen einlädt und in verschiedenen Blautönen schimmert. Das Lichtdesign von Udo Haberland unterstützt diese visuelle Metapher des fliessenden Wassers. Auch die Musik nimmt das Bild des Flusses auf. Vietnamesische Klänge und klassische Kompositionen von Chopin oder Ravel verschmelzen harmonisch oder sorgen für abrupte Richtungswechsel. Dies spiegelt die kulturellen Einflüsse und Vermischungen im ehemaligen Indochina wider.
Choreografie als Kalligrafie: Das Ensemble in Hochform
Goeckes Choreografie wirkt stellenweise wie eine Kalligrafie. Schnelle, mechanische Bewegungen zeichnen sich in den Raum, unterbrochen von virtuosen Pirouetten und Sprüngen. Das neu formierte Ensemble zeigt sich in Hochform und vermag auch eine Dorfgemeinschaft heraufzubeschwören, die in ihrer Kollektivität beängstigend wirkt. Sandra Bourdais verkörpert das Mädchen mit einer bemerkenswerten Gelassenheit. Sie stürzt sich in eine Beziehung, die weder von ihrer eigenen Familie noch vom Vater des reichen Liebhabers (Dayne Florence) geduldet wird. Am Ende verlässt sie die Szene so plötzlich, wie sie gekommen ist, und reist nach Paris ab.
«Wir waren wilde Tiere.»
Getanzte Psychogramme und die Grenzen der Adaption
Goecke setzt auf getanzte Psychogramme, um die komplexen Familienverhältnisse darzustellen. Ein inniges Pas de Deux zwischen Mutter (Ana Paula Camargo) und Tochter sowie die gewaltsame Auseinandersetzung zwischen dem Liebhaber und seinem Vater sind Beispiele dafür. Diese Darstellungsweise funktioniert jedoch nur bedingt. Duras' Geschichte enthält Elemente, die auch in anderen berühmten Liebesgeschichten zu finden sind: zwei Liebende in einem feindlichen Umfeld. Die spezifische Tiefe der Geschichte, insbesondere die „Amour Fou“ unter den Bedingungen von Klassismus und Rassismus, geht im Ballett teilweise verloren. Die von Duras beschriebene Begegnung war alles andere als unproblematisch. Beide Protagonisten sind den gesellschaftlichen Vorurteilen ihrer Zeit ausgesetzt. Aus heutiger Sicht kann die Geschichte auch als Missbrauch einer Minderjährigen interpretiert werden, die von ihrer eigenen Familie vernachlässigt wurde.
Die Mutter betrachtet ihre Tochter mit Stolz, wenn diese alle Blicke auf sich zieht. In Duras' früherem Roman «Heisse Küste» geht das Mädchen die Beziehung zu dem reichen Fremden auch ein, um ihre Familie zu retten, die dieses Verhalten stillschweigend fördert und gleichzeitig verachtet. Das Wort „Kind“ taucht auch in «Der Liebhaber» häufig auf. Nur mithilfe von Textzitaten kann das Ballett diese Problematik ansatzweise erfassen. Ein eindringlicher Moment ist, als das Mädchen «Maman» in die Stille ruft, doch nicht die Mutter, sondern der Liebhaber erscheint. Dieser Moment fängt das Unbehagen ein, das Duras' Lektüre oft begleitet. Ein abschliessendes Textzitat am Ende des Stücks verdeutlicht die anhaltende Liebe des Liebhabers, der die inzwischen zur Schriftstellerin gewordene Geliebte aus Paris anruft und ihr versichert, sie bis zu seinem Tod zu lieben, obwohl er mittlerweile verheiratet ist.
Duras' Sicht auf die Adaption
Hätte Duras dieses Ballett gemocht? Goecke selbst beantwortete diese Frage in einem Interview im Programmheft mit einem klaren «Nein, sie würde das nicht mögen.» Duras äusserte sich einst zu ihrem Welterfolg:
«Der Liebhaber ist ein Haufen Scheisse. Es ist ein Flughafenroman. Ich habe ihn geschrieben, als ich betrunken war.»
Diese Aussage unterstreicht die komplexe Beziehung der Autorin zu ihrem eigenen Werk und dessen Rezeption. Die Inszenierung im Theater Basel bietet dem Publikum eine neue Perspektive auf diesen Jahrhundertroman, auch wenn sie nicht alle Facetten der literarischen Vorlage vollständig abbilden kann. Die Vorstellungen finden auf der Grossen Bühne des Theater Basel statt.