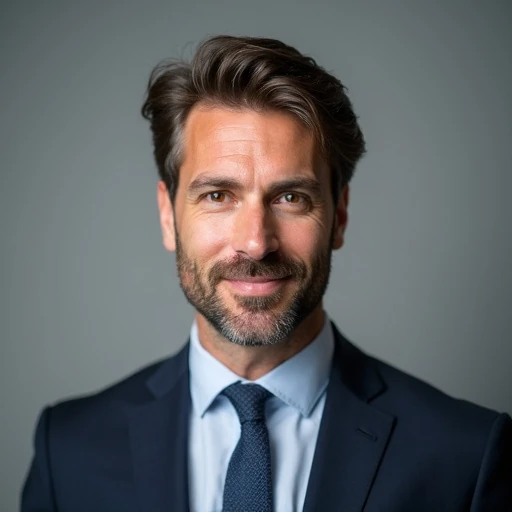Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt befasst sich am Mittwoch mit einer Volksinitiative. Sie fordert den direkten Abzug von Steuern vom Lohn. Ziel ist es, Steuerschulden zu verhindern. Die Initiative mit dem Titel «Keine Steuerschulden dank Direktabzug» wird kontrovers diskutiert. Zwei Gegenvorschläge liegen ebenfalls vor. Die Entscheidung des Grossen Rates wird als richtungsweisend betrachtet.
Wichtige Punkte
- Die Volksinitiative fordert den automatischen Steuerabzug vom Lohn.
- Steuerschulden sind ein grosses Problem in Basel und der Schweiz.
- Es gibt zwei Gegenvorschläge zur Initiative.
- Arbeitgeber müssten den Abzug für die meisten Lohnempfänger vornehmen.
- Hauptargumente betreffen Schuldenprävention und administrativen Aufwand.
Das Problem der Steuerschulden
Alle Beteiligten sind sich einig: Steuerschulden stellen ein erhebliches Problem dar. Sie gelten neben den Krankenkassenprämien als eine der Hauptursachen für die Überschuldung von Privatpersonen. In Basel-Stadt werden jährlich etwa 5000 Personen betrieben. Die Budget- und Schuldenberatungsstelle Plusminus in Basel, vertreten durch Jürg Gschwend, berichtet, dass Steuerschulden seit Jahren rund 30 Prozent der gesamten Schuldensumme ausmachen. Dies macht sie zum grössten Schuldenproblem der Schweiz. Gemäss Bundesamt für Statistik hatten im Jahr 2021 schweizweit 7,5 Prozent der Haushalte Steuerschulden.
Faktencheck
- 5000 Personen werden jährlich in Basel-Stadt betrieben.
- Steuerschulden machen etwa 30 Prozent der gesamten Schuldensumme aus.
- 7,5 Prozent der Schweizer Haushalte hatten 2021 Steuerschulden.
Inhalt der Volksinitiative
Die Volksinitiative «Keine Steuerschulden dank Direktabzug» zielt darauf ab, Schuldenkarrieren zu unterbinden. Sie schlägt vor, dass Steuern – oder zumindest ein Teil davon – in Basel direkt vom Lohn abgezogen werden. Arbeitgeber würden diese Beträge direkt an die Steuerverwaltung überweisen. Dieses System würde standardmässig für alle Lohnempfänger gelten, die in Basel wohnen und dort arbeiten. Eine Ausnahme wäre nur möglich, wenn die Personen ausdrücklich darauf verzichten, das sogenannte Opt-out-Prinzip.
Die Höhe des Abzugs soll sich am Quellensteuerabzug orientieren. Für den zusätzlichen administrativen Aufwand erhalten Arbeitgeber eine Bezugsprovision. Der Regierungsrat legt deren Höhe fest. Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden wären nicht verpflichtet, den direkten Abzug anzubieten.
Erster Gegenvorschlag der Kommission
Die Mehrheit der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) – sieben Mitglieder – lehnt die Initiative ab. Ihr Gegenvorschlag setzt auf andere staatliche Massnahmen zur Vermeidung von Steuerschulden. Künftig sollen alle Steuerpflichtigen in Basel-Stadt unaufgefordert eine provisorische Rechnung erhalten. Diese soll dazu anregen, den geschätzten Steuerbetrag bereits im laufenden Steuerjahr zu bezahlen. Personen mit bestehenden Steuerschulden sollen zu monatlichen Teilzahlungen aufgefordert werden. Dies soll die finanzielle Belastung über das Jahr verteilen. Zudem sollen Betroffene durch die Inkassostelle persönlich motiviert werden, niederschwellige Beratungsangebote anzunehmen.
Hintergrund: Gegenvorschläge
Gegenvorschläge sind in der Schweizer Politik üblich. Sie bieten eine Alternative zu Volksinitiativen. Damit sollen die Anliegen der Initiative aufgegriffen, aber mögliche Nachteile abgemildert werden. Dies führt oft zu einer breiteren Akzeptanz.
Zweiter Gegenvorschlag: Eine modifizierte Lösung
Die Minderheit der WAK – sechs Mitglieder – unterstützt das Grundanliegen der Initiative. Um der Wirtschaft entgegenzukommen, wurde ein entschärfter Gegenvorschlag erarbeitet. Dieser betont, dass das Opt-out-Prinzip entscheidend ist, um eine höhere Beteiligung in Risikogruppen zu erreichen. Auch dieser Gegenvorschlag sieht einen direkten Lohnabzug vor, es sei denn, der Lohnbezüger lehnt ihn ausdrücklich ab.
Für eine vereinfachte Umsetzung soll der Steuerabzug nicht nach Quellensteuer berechnet werden. Stattdessen beträgt er 10 Prozent des Bruttolohns. Für Einwohner von Riehen und Bettingen sind 5 Prozent vorgesehen. Die Pflicht zum Direktabzug würde erst für Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitenden gelten. Auch hier ist eine Bezugsprovision für die Arbeitgeber vorgesehen.
Steuererklärung bleibt obligatorisch
Unabhängig von einem Direktabzug müssen Steuerpflichtige weiterhin eine Steuererklärung ausfüllen. Die abgezogenen Beträge gelten lediglich als Vorauszahlungen. Die definitive Höhe der Steuern wird erst durch die genauen Angaben in der Steuererklärung festgesetzt.
Argumente für einen Direktabzug
Befürworter sehen im automatischen Direktabzug eine wichtige Präventionsmassnahme gegen Steuerschulden. Diese stehen oft am Anfang einer Schuldenspirale. Ein Abzug an der Lohnquelle soll das Verschuldungsrisiko senken.
- Arbeitnehmende sehen direkt, wie viel Geld ihnen monatlich tatsächlich zur Verfügung steht. Dies fördert die Budgetdisziplin.
- In finanziell kritischen Lebensphasen, wie dem Berufseinstieg, der Familiengründung oder nach einer Trennung/Scheidung, wirkt der Direktabzug präventiv. Ein Teil der Steuern ist bereits beglichen, was finanzielle Engpässe mildert.
- Ein Gutachten von Fehr Advice zeigt, dass ein standardmässiger Direktabzug (Opt-out-Prinzip) Steuerschulden und die Gesamtverschuldung mittel- bis langfristig reduziert.
- Der Kanton Basel-Stadt bietet seinen Staatsangestellten bereits einen freiwilligen Lohnabzug an. Im Jahr 2024 betrug der Aufwand pro teilnehmende Person und Jahr rund 0,1 Arbeitsstunden. Für externe Arbeitgeber wird der Aufwand auf etwa 0,3 Stunden geschätzt.
"Steuerschulden sind eine Hauptursache für die Überschuldung. Ein automatischer Direktabzug kann hier präventiv wirken und Menschen vor einer Schuldenspirale bewahren."
Argumente gegen einen Direktabzug
Der Regierungsrat und andere Kritiker sehen den geforderten Direktabzug als nicht geeignet an, um Schulden zu reduzieren. Dies liegt an der Freiwilligkeit des Opt-out-Prinzips. Es sei nicht sichergestellt, dass Betroffene ihn nutzen würden.
- Personen mit knappen Finanzen würden den direkten Abzug wahrscheinlich abwählen.
- Bei Lohnpfändungen würde der Direktabzug dazu führen, dass der Staat sich selbst gegenüber privaten Gläubigern bevorzugt. Dies ist rechtlich nicht zulässig.
- Steuerpflichtige mit ausreichendem Einkommen haben bereits heute die Möglichkeit, freiwillig Vorauszahlungen zu leisten.
- Der Abzug würde nur Arbeitnehmende mit Wohnsitz und Arbeitsstelle im Kanton Basel-Stadt betreffen, die nicht quellenbesteuert sind. Dies sind geschätzte 40’000 von insgesamt 97’100 Erwerbstätigen.
- Für den Kanton würden hohe Mehrkosten entstehen: etwa 140’000 Franken für zusätzlichen Vergütungszinsaufwand, 3,4 Millionen Franken für die Bezugsprovision an Arbeitgeber, 1,6 bis 2,3 Millionen Franken für einmalige IT-Kosten sowie Betriebskosten und Personalkosten von 144’000 bis 234’000 Franken.
- Unternehmen hätten einen erheblichen Mehraufwand, besonders wenn die Bemessung analog zur Quellensteuer erfolgen würde.