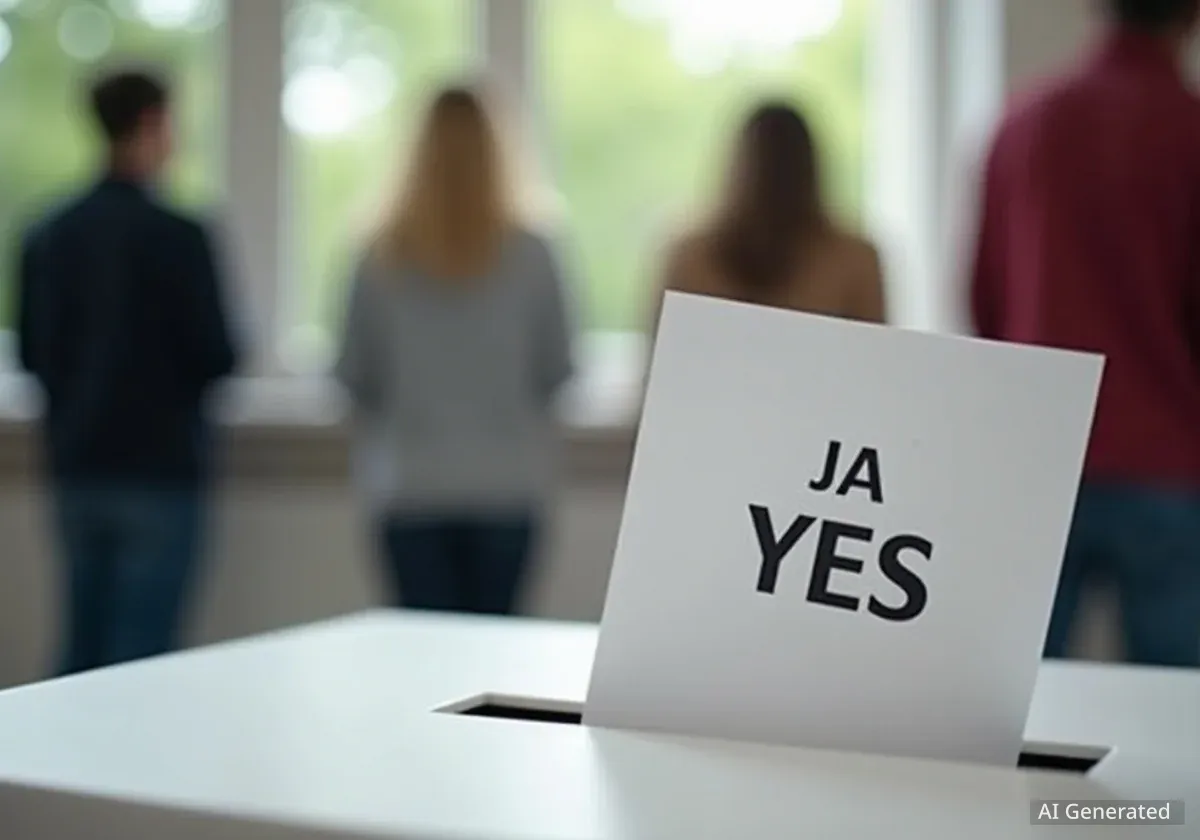Die Schweizer Stimmberechtigten haben sich überraschend deutlich für die Abschaffung der Besteuerung des Eigenmietwerts ausgesprochen. Dieser Entscheid betrifft Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum. Die Umsetzung der Reform wird jedoch voraussichtlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen.
Das Resultat der Abstimmung zeigt eine klare Tendenz, auch wenn sich die Kantone unterschiedlich positionierten. Die Vorlage wurde in der Mehrheit der Kantone angenommen, stieß aber in einigen Regionen auf Widerstand.
Wichtige Punkte
- 57,7 Prozent Ja-Stimmen für die Abschaffung des Eigenmietwerts.
- 19 Kantone stimmten zu, 7 Kantone lehnten die Vorlage ab.
- Romandie und Basel-Stadt sprachen sich mehrheitlich gegen die Abschaffung aus.
- Inkraftsetzung der Reform frühestens 2028 erwartet.
- Der Hauseigentümerverband HEV feiert den Abstimmungssieg.
Klares Abstimmungsresultat mit regionalen Unterschieden
Am Abstimmungssonntag sprachen sich 1.579.300 Stimmende für die Abschaffung des Eigenmietwerts aus. Demgegenüber standen 1.156.600 Nein-Stimmen. Dies entspricht einem Ja-Anteil von 57,7 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,5 Prozent. Das Ständemehr war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, da 19 Kantone die Vorlage annahmen und nur 7 sie ablehnten.
Die Abstimmung offenbarte eine deutliche geografische Trennung, oft als Röstigraben bezeichnet. Die sechs Kantone der Romandie lehnten die Vorlage mehrheitlich ab. Die Deutschschweizer Kantone hingegen stimmten mehrheitlich zu. Eine Ausnahme bildete der Kanton Basel-Stadt, der mit rund 53 Prozent der Stimmen ebenfalls den Eigenmietwert beibehalten wollte.
Abstimmungsergebnisse im Überblick
- Ja-Stimmen: 1.579.300 (57,7%)
- Nein-Stimmen: 1.156.600
- Stimmbeteiligung: 49,5%
- Kantone mit Ja: 19
- Kantone mit Nein: 7
Position des Kantons Basel-Landschaft
Im Kanton Basel-Landschaft stimmten die Bürgerinnen und Bürger mit 60,5 Prozent für die Abschaffung der Besteuerung des Wohneigentums. Diese Zustimmung war in fast allen Gemeinden und Bezirken des Kantons spürbar. Lediglich Birsfelden mit 57,3 Prozent Nein-Stimmen und Oltingen mit 51 Prozent Nein-Stimmen bildeten Ausnahmen.
Die höchste Zustimmung fand die Vorlage im Bezirk Laufen mit 67,5 Prozent Ja-Stimmen. Es folgten Waldenburg mit 64,4 Prozent und Sissach mit 63 Prozent. Der Bezirk Arlesheim wies mit 58,5 Prozent die tiefste Ja-Rate auf. Liestal lag bei 60,3 Prozent Ja-Stimmen.
Besonders deutlich war die Ablehnung des Eigenmietwerts in Liesberg, wo exakt drei von vier Abstimmenden der Abschaffung zustimmten. Auch Lauwil (74,3 Prozent), Roggenburg (74 Prozent), Giebenach (73,9 Prozent), Pfeffingen (73 Prozent) und Ramlinsburg (72,9 Prozent) zeigten eine sehr hohe Zustimmung.
Hintergrund zum Eigenmietwert
Der Eigenmietwert ist eine fiktive Einnahme, die Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum versteuern müssen. Er basiert auf dem Wert, den die Miete des eigenen Hauses oder der Wohnung auf dem freien Markt erzielen würde. Kritiker bemängelten seit Langem eine ungerechte Doppelbesteuerung, da gleichzeitig Hypothekarzinsen und Unterhaltskosten von den Steuern abgezogen werden konnten.
Politische Kräfte und die Rolle der Gebirgskantone
Das Abstimmungsergebnis zeigt, dass in Zentrumsgemeinden mit vielen Mietwohnungen die Zustimmung zur Abschaffung unter dem kantonalen Durchschnitt lag. Auffällig war auch die Haltung der Gebirgskantone. Obwohl deren Regierungen die Ablehnung der Vorlage empfohlen hatten, stimmten die Stimmberechtigten in den deutsch-, italienisch- und rätoromanischsprachigen Tourismusgebieten klar dafür. Eine Ausnahme bildete das Wallis, wo der französischsprachige Teil des Kantons ablehnte.
Der Abstimmungssieg wird dem Hauseigentümerverband (HEV), verschiedenen Wirtschaftsverbänden sowie den Parteien SVP, FDP und Die Mitte zugeschrieben. Dies ist bemerkenswert, da Hauseigentümerinnen und -eigentümer in der Schweiz gegenüber Mietenden in der Minderzahl sind. Der HEV Schweiz, unter der Leitung von Direktor Markus Meier, hatte die Besteuerung als ungerecht kritisiert.
Markus Meier, Direktor des HEV Schweiz, bezeichnete das Ergebnis als «überraschend deutlich und unmissverständlich».
Er würdigte auch den verstorbenen alt Nationalrat Hans Rudolf Gysin, der sich auf kantonaler und nationaler Ebene für die Abschaffung des Eigenmietwerts eingesetzt hatte. Meier betonte, Gysin hätte diese Entwicklung mit grosser Genugtuung erlebt.
Im gegnerischen Lager standen die Kantone, insbesondere die Gebirgskantone, die Parteien SP und Grüne, der Mieterinnen- und Mieterverband sowie Verbände wie Bauenschweiz und Swisscleantech und der Gemeindeverband. Die Linke hatte vor möglichen Steuererhöhungen gewarnt, die auch Mieterinnen und Mieter belasten könnten.
Inkraftsetzung und künftige Steuerpraxis
Die Gebirgskantone befürchteten erhebliche Einnahmeverluste durch die Abschaffung des Eigenmietwerts. Nun müssen die Kantone entscheiden, ob sie eine Zweitwohnungssteuer einführen wollen. Die Konferenz der Kantonsregierungen hatte diese neue Sondersteuer vor dem Urnengang als «keine befriedigende Lösung» bezeichnet.
Finanzministerin Karin Keller-Sutter (FDP) erklärte am Abstimmungssonntag, dass die Reform frühestens 2028 in Kraft treten dürfte. Das genaue Datum der Inkraftsetzung sei noch offen. Diese Frist soll den Kantonen ausreichend Zeit geben, sich auf die Umstellung vorzubereiten und entsprechende kantonale Regelungen zu treffen.
HEV-Direktor Meier befürwortet eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Diese Zeit sei ausreichend, damit die Kantone eine kantonale Liegenschaftssteuer auf überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften einführen könnten. Er betonte jedoch, dass die Verfassungsänderung seit dem Abstimmungssonntag in Kraft sei und das Stimmvolk eine längere Verzögerung nicht akzeptieren würde. «Zwei Jahre müssen machbar sein», so Meier.
Die Reform wird weitreichende Auswirkungen auf die Immobilienbesteuerung in der Schweiz haben. Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum werden finanziell entlastet. Gleichzeitig müssen die Kantone neue Wege finden, um mögliche Steuerausfälle zu kompensieren. Die Diskussionen über die genaue Ausgestaltung der kantonalen Steuerpolitik werden in den kommenden Jahren fortgesetzt.