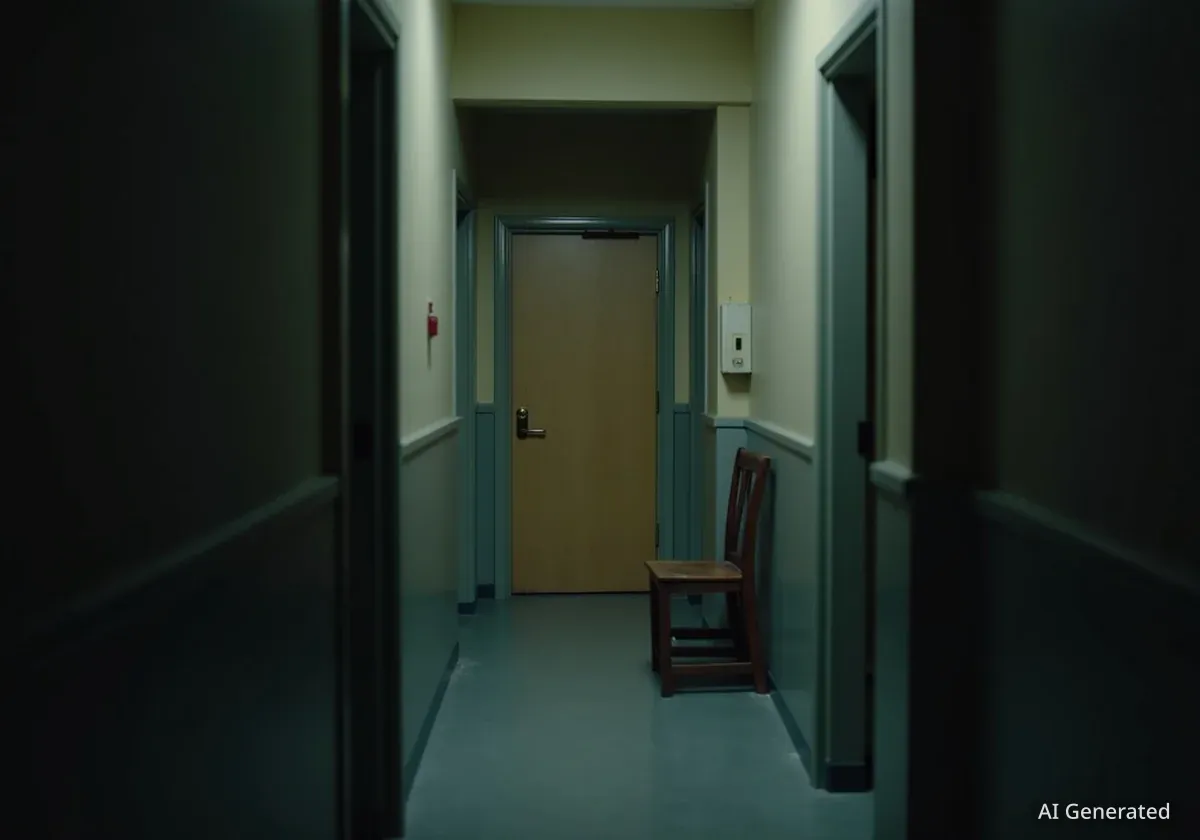Die Schutzunterkünfte für gewaltbetroffene Frauen und Kinder in der Region Basel sind stark überlastet. Im Jahr 2024 mussten das Frauenhaus beider Basel und das Angebot der Heilsarmee insgesamt 334 schutzsuchende Frauen abweisen. Die Zahl der Anfragen hat sich in den letzten fünf Jahren vervierfacht, was die bestehenden Kapazitäten an ihre Grenzen bringt und den dringenden Handlungsbedarf verdeutlicht.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Anfragen an die Basler Frauenhäuser haben sich in den letzten fünf Jahren vervierfacht.
- Im Jahr 2024 wurden 334 Frauen aufgrund von Platzmangel abgewiesen.
- Die durchschnittliche Auslastung der 33 verfügbaren Schutzplätze lag bei 93 Prozent.
- Gemäss der Istanbul-Konvention fehlen in der Region Basel zehn zusätzliche Familienzimmer.
- Eine kürzliche Erhöhung der Kantonsbeiträge um 280'000 Franken reicht laut der Leitung des Frauenhauses nicht aus, um neue Plätze zu schaffen.
Ein System unter permanentem Druck
Die Situation in den Schutzeinrichtungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft ist alarmierend. Das Frauenhaus beider Basel (FHbB) und das Angebot «Wohnen für Frauen und Kinder» (WFK) der Heilsarmee stellen gemeinsam 33 Schutzplätze zur Verfügung. Diese Plätze sind jedoch fast durchgehend belegt, was die Einrichtungen zwingt, immer häufiger Hilfeanfragen abzulehnen.
Die Zahlen, die aus einer Antwort des Regierungsrats auf einen politischen Vorstoss von EVP-Grossrat Christoph Hochuli hervorgehen, zeichnen ein düsteres Bild. Die Vervierfachung der Anfragen innerhalb von nur fünf Jahren zeigt eine wachsende Notlage. Gewaltbetroffene Frauen befinden sich in einer extrem verletzlichen Situation und sind auf schnelle und unkomplizierte Hilfe angewiesen. Wenn diese Hilfe nicht gewährleistet werden kann, hat das gravierende Folgen.
Die Realität hinter den Abweisungen
Eine Abweisung bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Frau komplett ohne Unterstützung bleibt. Die Institutionen sind stark vernetzt und bemühen sich intensiv um alternative Lösungen. So konnte das FHbB im vergangenen Jahr 63 Personen an andere Schutzeinrichtungen, wie das WFK, vermitteln. In 14 weiteren Fällen fand die Opferhilfe beider Basel einen Notfallplatz.
In besonders gefährlichen Hochrisikofällen, in denen die Sicherheit der Betroffenen akut bedroht ist, werden Plätze in ausserkantonalen Schutzunterkünften organisiert. Diese Notlösungen sind jedoch mit grossem Aufwand verbunden und reissen die Betroffenen und ihre Kinder aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld.
Zahlen zur Auslastung 2024
- Verfügbare Plätze: 33
- Durchschnittliche Belegung: 93 %
- Abgewiesene Frauen: 334
- Alternative Vermittlungen (FHbB): 63
- Notfallplätze (Opferhilfe): 14
Internationale Verpflichtungen und lokaler Bedarf
Die Schweiz hat sich durch die Ratifizierung der Istanbul-Konvention im Jahr 2018 dazu verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu bekämpfen. Ein zentraler Punkt des Übereinkommens ist die Bereitstellung von ausreichend Schutzunterkünften.
Die Konvention gibt einen klaren Richtwert vor: Pro 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner soll ein Familienzimmer zur Verfügung stehen. Für die Region Basel bedeutet dies, dass zehn zusätzliche Zimmer fehlen, um den internationalen Standard zu erfüllen und auch in Spitzenzeiten allen Schutzsuchenden einen Platz garantieren zu können.
Was ist die Istanbul-Konvention?
Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Sie trat für die Schweiz am 1. April 2018 in Kraft. Die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten zu umfassenden Massnahmen in den Bereichen Prävention, Schutz, Strafverfolgung und koordiniertes Vorgehen.
Finanzierung: Eine komplexe Herausforderung
Kürzlich wurde die Leistungsvereinbarung zwischen den Kantonen und dem Frauenhaus beider Basel erneuert. Dabei wurden die staatlichen Beiträge erhöht. Basel-Stadt steuert rund 20'000 Franken mehr bei, Baselland rund 260'000 Franken. Insgesamt erhält das FHbB somit 280'000 Franken zusätzlich pro Jahr.
Doch diese Summe reicht bei weitem nicht aus, um die dringend benötigten Plätze zu schaffen. Bettina Bühler, die Geschäftsführerin des FHbB, machte in einem Interview deutlich, dass die Kantonsbeiträge nur etwa die Hälfte der Betriebskosten decken.
"Die Erhöhung der Staatsbeiträge reicht nicht, um mehr Schutzplätze schaffen zu können. Die Kantone übernehmen nur 50 Prozent der Kosten, den Rest finanzieren wir über Fundraising, Spenden und auch Beiträge von Klientinnen."
Diese Finanzierungslücke zwingt das Frauenhaus, kontinuierlich auf private Spenden und andere Einnahmequellen angewiesen zu sein, was die langfristige Planungssicherheit erheblich erschwert. Die Abhängigkeit von Spenden macht es schwierig, nachhaltige Erweiterungen zu finanzieren und das Personal aufzustocken.
Politik sucht nach Lösungen
Die prekäre Situation hat die Politik alarmiert. Grossrat Christoph Hochuli, dessen Vorstoss die aktuellen Zahlen ans Licht brachte, zeigt sich besorgt. Er hinterfragt, warum die Beiträge im Rahmen der Leistungsvereinbarung nicht stärker erhöht wurden, obwohl die Engpässe seit langem bekannt sind. Er plant nun Gespräche mit der Leitung des Frauenhauses und erwägt einen weiteren, verbindlichen Vorstoss, der eine konkrete Erhöhung der Plätze fordern soll.
Auch im Kanton Basel-Landschaft ist das Thema auf der politischen Agenda. SP-Landrätin Juliana Weber Killer hat eine Interpellation eingereicht. Sie will von der Regierung wissen, wie sie die hohe Abweisungsquote bewertet und ob kurzfristige Massnahmen geplant sind, um die Finanzierung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
Prävention und Übergangswohnungen als Teil der Strategie
Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) des Kantons Basel-Stadt verweist auf verschiedene Massnahmen. Laut Mediensprecher Toprak Yerguz wurde die Finanzhilfe an das WFK «signifikant erhöht», wodurch immerhin ein zusätzlicher Schutzplatz geschaffen werden konnte. Zudem wird auf das Programm «PasserElle» verwiesen, das sieben Plätze für Frauen und Kinder bietet, die bereit für den Übergang in ein ambulantes Angebot sind.
Auch das WFK prüft aktuell eine Erweiterung seines Angebots durch Übergangswohnungen. Solche Wohnungen können den Druck auf die Notunterkünfte reduzieren, indem sie Frauen, die nicht mehr den intensiven Schutz eines Frauenhauses benötigen, eine sichere und begleitete Wohnform bieten.
Parallel dazu setzen die Kantone auf präventive Massnahmen. Kampagnen zur öffentlichen Ächtung von häuslicher Gewalt sollen langfristig dazu beitragen, dass weniger Gewalt ausgeübt wird. Doch bis diese Massnahmen greifen, bleibt der Bedarf an sicheren Schutzplätzen akut und drängend.