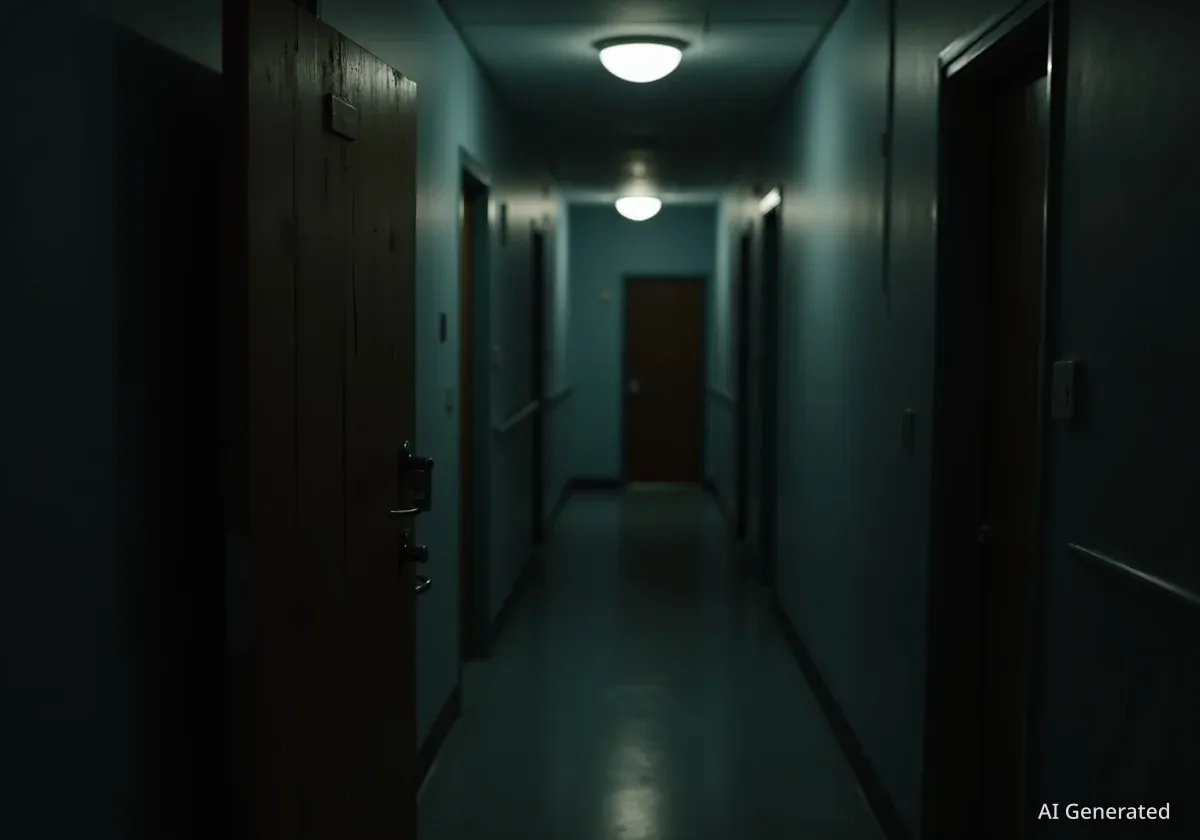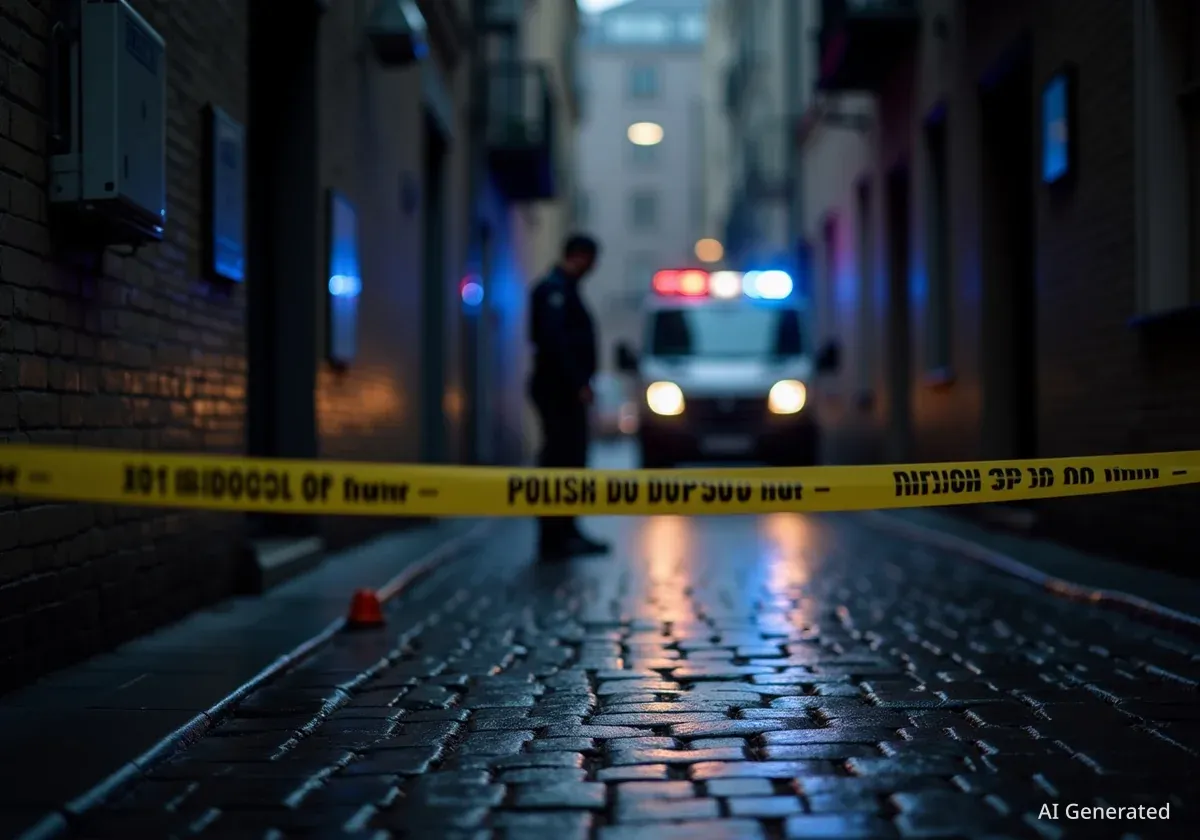Die Frauenhäuser in Basel-Stadt sehen sich zunehmend mit einer Überlastung konfrontiert. Eine aktuelle Anfrage bei der Regierung zeigt, dass die Zahl der Abweisungen von Gewaltbetroffenen in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Dies betrifft Frauen, Männer und Kinder, die Schutz und Unterstützung suchen.
Wichtige Punkte
- Anstieg der Abweisungen in Basler Frauenhäusern.
- Hauptgrund ist Bettenmangel, nicht mangelnde Qualifikation.
- Kantonale Finanzierung deckt nur einen Teil der Kosten ab.
- Die Nachfrage nach Schutzplätzen übersteigt das Angebot.
- Mehrfachbetroffenheit von Gewalt fordert spezialisierte Hilfe.
Steigende Abweisungszahlen in Basler Frauenhäusern
Die Frauenhäuser in Basel-Stadt mussten im Jahr 2022 insgesamt 267 Anfragen von gewaltbetroffenen Personen ablehnen. Dies geht aus der Antwort des Regierungsrates auf eine Interpellation von Grossrätin Andrea Elisabeth Knellwolf hervor. Im Vergleich dazu lag die Zahl der Abweisungen im Jahr 2021 bei 225 und im Jahr 2020 bei 188. Dieser Trend zeigt eine klare Zunahme der Nichtaufnahme von Schutzsuchenden.
Die Gründe für diese Abweisungen sind vielfältig, doch der primäre Faktor ist der Mangel an freien Betten. Die Frauenhäuser können die hohe Nachfrage nach Schutzplätzen nicht mehr ausreichend decken. Dies betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.
Faktencheck
- 2020: 188 Abweisungen
- 2021: 225 Abweisungen
- 2022: 267 Abweisungen
Dies entspricht einem Anstieg von fast 42% innerhalb von zwei Jahren.
Hintergrund der Überlastung
Die Frauenhäuser in Basel-Stadt sind zentrale Anlaufstellen für Menschen, die vor häuslicher Gewalt fliehen. Sie bieten nicht nur einen sicheren Unterschlupf, sondern auch psychosoziale Betreuung, Rechtsberatung und Unterstützung bei der Wiedereingliederung in ein gewaltfreies Leben. Die steigenden Abweisungszahlen deuten auf eine systemische Lücke im Schutzsystem hin.
Gemäss dem Regierungsrat sind die Basler Frauenhäuser darauf ausgelegt, Notfälle aufzunehmen. Die Abweisungen erfolgen jedoch nicht aufgrund mangelnder Qualifikation der Betroffenen oder fehlender Dringlichkeit. Vielmehr ist es die Begrenzung der physischen Kapazität, die zu diesen Ablehnungen führt. Dies stellt eine grosse Herausforderung für die betroffenen Personen dar, die dringend Hilfe benötigen.
«Jede Abweisung bedeutet, dass eine Person, die Schutz vor Gewalt sucht, diesen nicht erhält. Das ist ein alarmierendes Signal für unser System des Opferschutzes.»
Finanzierung und Kapazität
Die kantonalen Beiträge für die Frauenhäuser decken einen Teil der Betriebskosten. Im Jahr 2022 betrug der kantonale Beitrag beispielsweise 1,8 Millionen Franken für das Frauenhaus Basel. Dieser Beitrag ist jedoch an die Anzahl der Betten gekoppelt, die vom Kanton finanziert werden. Eine Erhöhung der Kapazität erfordert zusätzliche finanzielle Mittel und eine Anpassung der Leistungsvereinbarungen.
Die Basler Frauenhäuser erhalten zudem Gelder von Gemeinden aus dem Einzugsgebiet, wenn Klientinnen aus diesen Gemeinden aufgenommen werden. Trotz dieser Finanzierungsmodelle bleibt die Lücke zwischen Bedarf und Angebot bestehen. Die aktuelle Situation erfordert eine Überprüfung der bestehenden Strukturen und Finanzierungsmodelle, um allen Gewaltbetroffenen Schutz bieten zu können.
Hintergrundinformationen
Häusliche Gewalt ist ein weitreichendes Problem, das alle sozialen Schichten betrifft. Die Schweiz hat sich mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, Massnahmen zur Prävention und Bekämpfung häuslicher Gewalt zu ergreifen. Dazu gehört auch die Bereitstellung ausreichender Schutzplätze für Betroffene.
Die Istanbul-Konvention fordert, dass pro 10.000 Einwohner mindestens ein Familienplatz in Frauenhäusern zur Verfügung steht. Für Basel-Stadt mit rund 200.000 Einwohnern wären dies 20 Familienplätze. Die aktuellen Kapazitäten liegen jedoch darunter.
Herausforderungen für Gewaltbetroffene mit Mehrfachproblemen
Ein weiterer Aspekt, der die Situation erschwert, ist die Mehrfachbetroffenheit vieler Klientinnen und Klienten. Viele Gewaltbetroffene leiden zusätzlich unter psychischen Problemen, Suchterkrankungen oder haben Traumata erlebt. Diese komplexen Bedürfnisse erfordern eine spezialisierte Betreuung, die nicht immer in jedem Frauenhaus sofort geleistet werden kann.
Im Jahr 2022 wurden 23 Personen wegen ihrer Mehrfachbetroffenheit abgewiesen. Diese Personen benötigten eine spezifischere Unterstützung, die über das reguläre Angebot hinausgeht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, nicht nur die Anzahl der Betten zu erhöhen, sondern auch die Qualität und Spezialisierung der Hilfsangebote zu verbessern.
Konsequenzen und Lösungsansätze
Die Abweisung von Gewaltbetroffenen hat schwerwiegende Konsequenzen. Sie können gezwungen sein, in einer gefährlichen Umgebung zu bleiben oder in unsichere Situationen zurückzukehren. Dies erhöht das Risiko weiterer Gewalt und erschwert den Ausstieg aus der Gewaltspirale.
Um die Situation zu verbessern, sind mehrere Massnahmen denkbar:
- Erhöhung der Bettenkapazität: Eine direkte Aufstockung der Plätze in den Frauenhäusern ist dringend notwendig.
- Ausbau spezialisierter Angebote: Schaffung von spezifischen Einrichtungen oder Programmen für Gewaltbetroffene mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen.
- Verbesserung der kantonalen Finanzierung: Anpassung der Beiträge, um eine bedarfsgerechte Finanzierung sicherzustellen.
- Stärkung der Präventionsarbeit: Langfristige Strategien zur Reduzierung häuslicher Gewalt sind essenziell.
Der Regierungsrat betont, dass die Situation ernst genommen wird und man sich der Problematik bewusst ist. Es wird geprüft, wie die Angebote in den Frauenhäusern bedarfsgerecht weiterentwickelt werden können, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und allen Gewaltbetroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren.
Blick in die Zukunft
Die steigenden Abweisungszahlen in den Basler Frauenhäusern sind ein deutliches Zeichen für einen wachsenden Bedarf an Schutz und Unterstützung. Die Politik und die Gesellschaft sind gefordert, Lösungen zu finden, um sicherzustellen, dass niemand, der vor Gewalt flieht, abgewiesen werden muss.
Die Zusammenarbeit zwischen kantonalen Behörden, Frauenhäusern und anderen Hilfsorganisationen ist entscheidend, um die bestehenden Lücken zu schliessen und ein umfassendes Schutzsystem für alle Gewaltbetroffenen zu gewährleisten. Nur so kann das Ziel der Istanbul-Konvention, ein gewaltfreies Leben für alle, erreicht werden.