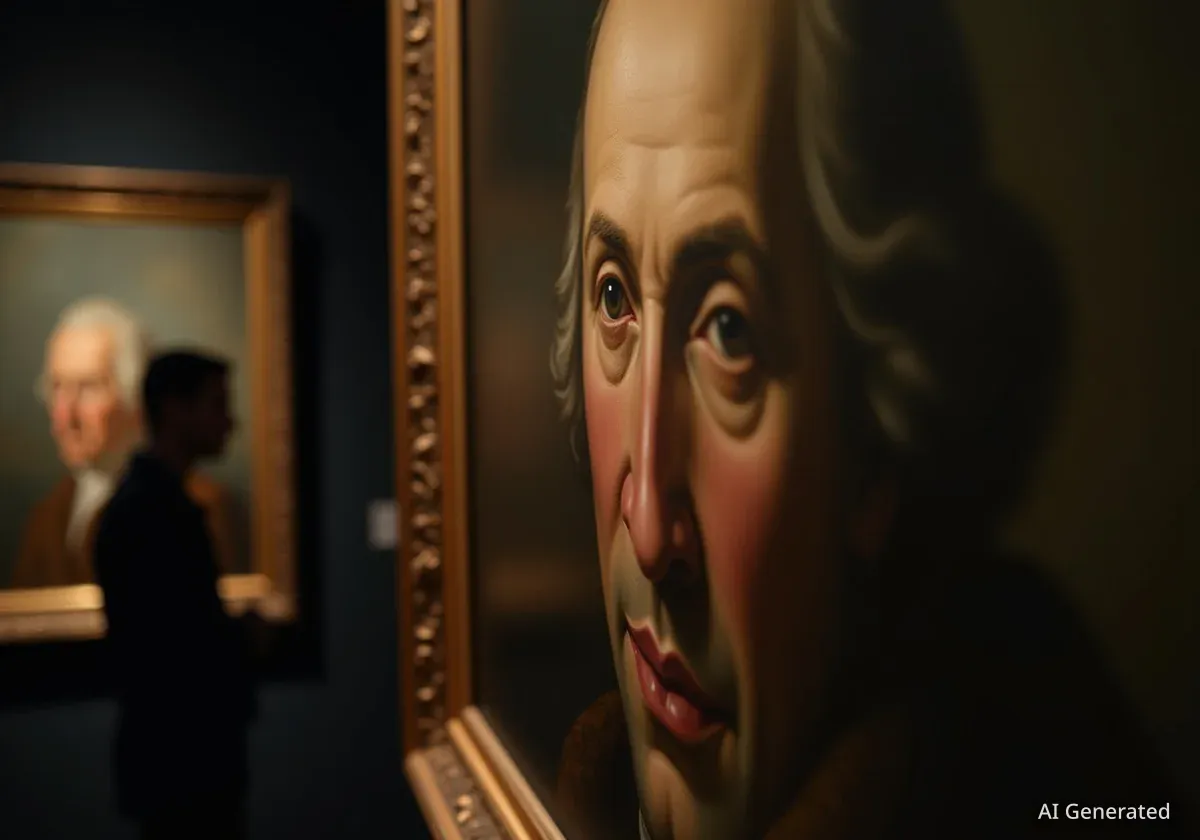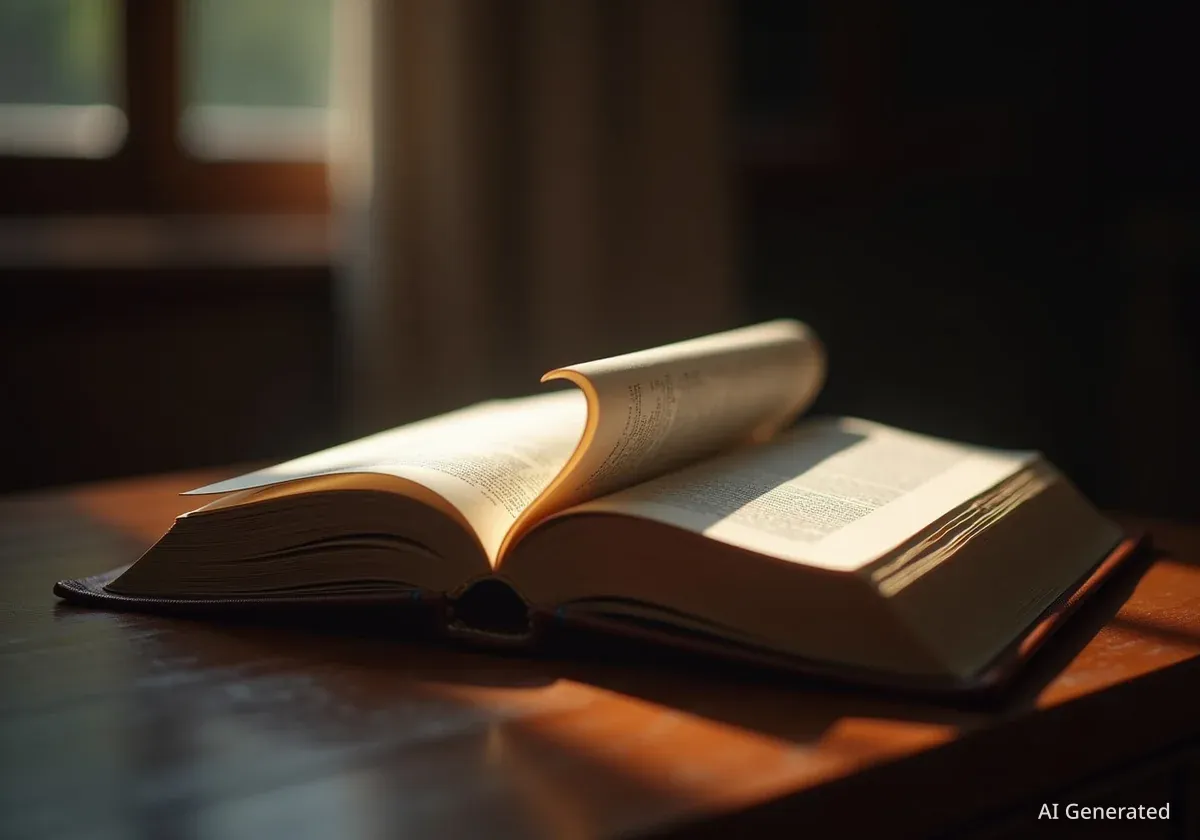Eines der berühmtesten Werke im Kunstmuseum Basel, das letzte Selbstporträt von Paul Gauguin, stand unter Fälschungsverdacht. Nach monatelangen wissenschaftlichen Untersuchungen präsentiert das Museum nun seine Ergebnisse: Das Gemälde ist echt, doch die Geschichte seiner Entstehung ist weitaus komplexer als bisher angenommen. Es trägt die Handschrift mehrerer Personen.
Das Wichtigste in Kürze
- Das Kunstmuseum Basel bestätigt die Echtheit von Paul Gauguins letztem Selbstporträt von 1903.
- Wissenschaftliche Analysen deckten Übermalungen mit Farben auf, die erst nach Gauguins Tod verfügbar waren.
- Experten gehen davon aus, dass es sich um ein Gemeinschaftswerk handelt, das Gauguin zusammen mit einem Freund vollendete.
- Das renommierte Pariser "Gauguin Komitee" stuft das Werk weiterhin als authentisch ein.
Ein Sammler weckt alte Zweifel
Im Frühling 2025 sorgte der Gauguin-Sammler Fabrice Fourmanoir für Aufsehen. Er behauptete, das «Portrait de l'artiste par lui-même» aus dem Jahr 1903 könne unmöglich vom Künstler selbst gemalt worden sein. Seine Argumente klangen plausibel: Gauguin sei kurz vor seinem Tod bereits zu krank gewesen, um ein solches Werk zu schaffen. Zudem fehle auf dem Bild die markante Hakennase, ein typisches Merkmal in den Selbstbildnissen des französischen Malers.
Dieser Verdacht war nicht neu. Bereits 1924 wurden Fragen zur Authentizität des Werkes laut. Die Kunsthalle Basel bezeichnete es 1928 vorsichtig als «mutmassliches Selbstbildnis». Fourmanoir ging sogar so weit, einen potenziellen Urheber zu benennen: Ky-Dong, ein Freund und Pfleger, der Gauguin in seinen letzten Lebensmonaten auf einer Südseeinsel zur Seite stand.
Ein Meisterwerk mit Fragezeichen
Das 1903 entstandene Selbstporträt gilt als das letzte bekannte Selbstbildnis Paul Gauguins. Der Künstler starb im Sommer desselben Jahres im Alter von 54 Jahren. Das Gemälde ist ein zentrales Werk der Sammlung des Kunstmuseums Basel und ein Publikumsmagnet.
Moderne Technik bringt die Wahrheit ans Licht
Das Kunstmuseum Basel nahm die Vorwürfe ernst und leitete eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung ein. In der Restaurationsabteilung wurde das Gemälde mit modernsten Methoden analysiert, um seine Geheimnisse zu entschlüsseln. Die Experten setzten dabei auf eine Kombination verschiedener Technologien.
Untersuchungen unter Normal- und UV-Licht, Infrarotreflektografie und Radiologie machten verborgene Schichten sichtbar. Mit diesen Verfahren lassen sich Dinge erkennen, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben, wie etwa Vorzeichnungen oder spätere Korrekturen. Zusätzlich wurden winzige Farbproben entnommen und mikroskopisch analysiert.
Die überraschende Entdeckung
Die Analysen bestätigten, dass an dem Gemälde gearbeitet wurde, nachdem es Gauguins Atelier verlassen hatte. «Neben dem Stirnbereich und beim Bart ist eine Übermalung erfolgt», erklärt Eva Reifert, Kuratorin am Kunstmuseum Basel. Die entscheidende Entdeckung war der Nachweis von Titanweiss in diesen Bereichen.
Titanweiss ist ein Farbpigment, das erst nach dem Tod von Paul Gauguin im Jahr 1903 in Künstlerfarben weit verbreitet war. Sein Vorhandensein beweist, dass jemand das Bild zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet hat.
Eine Fälschungsabsicht schliesst die Kuratorin jedoch aus. Wahrscheinlicher sei, dass das Werk während seines langen Transports von der Südsee nach Europa beschädigt wurde. «Vermutlich habe jemand das Bild nur ‹aufhübschen› wollen. Da habe man abgeriebene Stellen übermalt», so Reifert. «Es ging wahrscheinlich auch um etwas Kosmetisches.»
Keine Fälschung, sondern ein Gemeinschaftswerk
Die Untersuchungsergebnisse stützen eine andere, faszinierende Theorie, die auch den von Fourmanoir ins Spiel gebrachten Freund Ky-Dong miteinbezieht. Eva Reifert erläutert, dass es in der Familie von Ky-Dong, dessen Name übersetzt «Wunderkind» bedeutet, Zeugnisse dafür gebe, dass dieser das Porträt begonnen habe.
«Man muss sich das skizzenmässig vorstellen. Gauguin hat es dann vollendet.»
Diese Erklärung würde viele der Ungereimtheiten auflösen. Wenn Ky-Dong die Grundzüge des Porträts anlegte, erklärt das, warum die charakteristische Hakennase fehlt und Gauguin mit blauen statt seinen tatsächlichen braunen Augen dargestellt ist. Gauguin hätte die skizzenhafte Vorlage seines Freundes dann in seinem eigenen Stil fertiggestellt.
Solche Gemeinschaftsarbeiten waren und sind in der Kunstwelt nicht unüblich. Das Werk wäre demnach kein alleiniges Selbstporträt, sondern das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit in den letzten Tagen des Künstlers.
Offiziell als echt bestätigt
Trotz der neuen Erkenntnisse über die Entstehungsgeschichte bleibt das Urteil der Fachwelt eindeutig. Das renommierte «Gauguin Komitee» in Paris, die höchste Instanz für die Echtheit seiner Werke, hat die Befunde geprüft. Ihre Schlussfolgerung ist klar: Es handle sich «ohne Zweifel um ein Werk Gauguins», teilt das Kunstmuseum mit.
Auch wenn einige Detailfragen offenbleiben, ist die Hauptsache geklärt. «Es ist aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieses Werk um 1903 im Atelier von Paul Gauguin entstanden ist», fasst Reifert zusammen. Das «Portrait de l'artiste par lui-même» bleibt somit als letztes, echtes Bild Gauguins im Kunstmuseum Basel hängen – nun aber mit dem Wissen, dass es eine noch tiefere und persönlichere Geschichte erzählt als bisher gedacht.