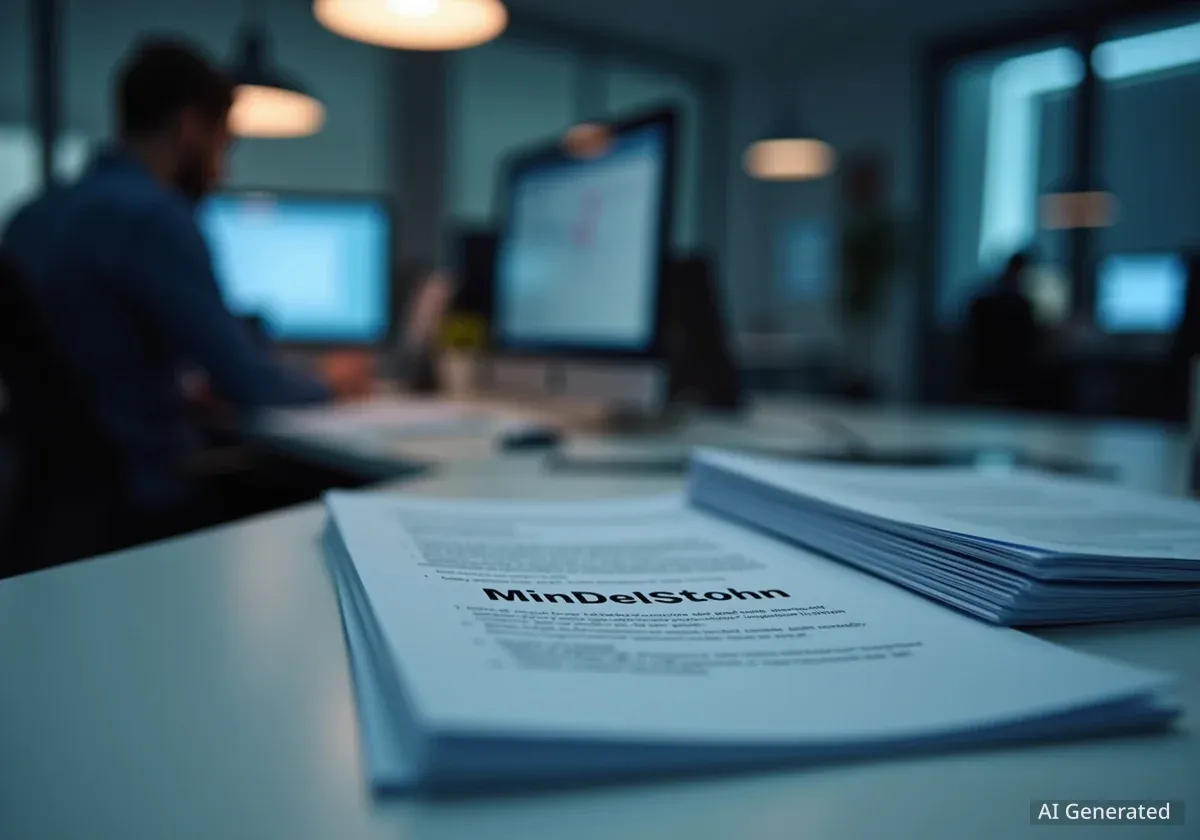In Basel-Stadt gilt seit Juli 2022 ein gesetzlicher Mindestlohn. Eine aktuelle Auswertung der kantonalen Arbeitsmarktinspektion zeigt, dass etwa 13 Prozent der kontrollierten Unternehmen gegen diese Vorschrift verstossen. Die meisten dieser Verstösse sind geringfügig, oft handelt es sich um Differenzen von wenigen Rappen pro Stunde. Es gibt jedoch auch gravierende Fälle, in denen Arbeitnehmer deutlich unter dem gesetzlichen Minimum bezahlt werden.
Wichtige Erkenntnisse
- 13 Prozent der kontrollierten Firmen in Basel-Stadt halten den Mindestlohn nicht ein.
- Die Mehrheit der Lohnunterschreitungen liegt zwischen 2 und 70 Rappen pro Stunde.
- Bei erheblichen Verstössen leitet die Arbeitsmarktinspektion Fälle an die Staatsanwaltschaft weiter.
- Der Mindestlohn in Basel-Stadt beträgt aktuell 22 Franken pro Stunde.
Der Basler Mindestlohn: Eine Einführung
Das Basler Stimmvolk hat im Sommer 2021 für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns gestimmt. Dieser trat im Juli 2022 in Kraft. Ursprünglich auf 21 Franken pro Stunde festgelegt, wurde der Mindestlohn seither regelmässig an die Teuerung angepasst. Aktuell beträgt er 22 Franken pro Stunde.
Die Einführung des Mindestlohns zielte darauf ab, Menschen vor Tiefstlöhnen zu schützen, die kaum zum Überleben reichen. Der Kanton Basel-Stadt kontrolliert jährlich hunderte Unternehmen, insbesondere in Branchen mit niedrigen Löhnen, um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewährleisten. Unternehmen, die ihren Angestellten zu wenig zahlen, müssen mit Bussen rechnen.
Faktencheck
- Inkrafttreten: Juli 2022
- Startlohn: 21 Franken pro Stunde
- Aktueller Lohn: 22 Franken pro Stunde
- Kontrollquote: Rund 13% der Firmen verstossen gegen die Regeln
Geringfügige Abweichungen dominieren das Bild
Recherchen der Basel Zeitung, basierend auf Kontrollberichten des kantonalen Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU), zeigen ein differenziertes Bild der Verstösse. Die meisten fehlbaren Firmen unterschreiten den Mindestlohn nur um geringe Beträge. Die Daten, die anonymisiert wurden, um Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Arbeitnehmer zu verhindern, offenbaren, dass die Differenzen zwischen dem tatsächlich gezahlten und dem gesetzlich vorgeschriebenen Stundenlohn oft im Bereich von 2 bis 70 Rappen liegen.
Ein Beispiel aus den Berichten zeigt, dass ein Beschäftigter 21.43 Franken pro Stunde erhielt, obwohl der damals vorgeschriebene Mindestlohn 21.45 Franken betrug. Solche minimalen Unterschreitungen führen in der Regel nicht zu einer Überweisung an die Staatsanwaltschaft. Die Inspektoren erteilen stattdessen eine Verwarnung und fordern die Nachzahlung der Lohndifferenz.
«Jede Unterschreitung des Mindestlohns, egal ob um wenige Rappen oder mehrere Franken, bedeutet, dass die betroffenen Arbeitnehmerinnen unter das Existenzminimum fallen», sagt Patrik Felber, Sprecher der Unia Aargau-Nordwestschweiz.
Gravierende Fälle und deren Folgen
Trotz der Dominanz geringfügiger Verstösse gibt es auch Ausreisser nach unten. In einem dokumentierten Fall erhielt ein Arbeitnehmer lediglich 13.74 Franken statt der zustehenden 21.45 Franken. Solche gravierenden Unterschreitungen sind jedoch nicht repräsentativ für das Gesamtbild. Das WSU beziffert die durchschnittliche Lohnunterschreitung im Kontrolljahr 2023 auf 50 Rappen pro Stunde.
Für einen Arbeitnehmer mit einem 100-Prozent-Pensum und einer 42-Stunden-Woche bedeutet eine Unterschreitung von 50 Rappen pro Stunde ein monatliches Minus von rund 84 Franken. Dies kann für Beschäftigte in Tieflohnbranchen, die ohnehin mit einem knappen Budget auskommen müssen, eine erhebliche Belastung darstellen. Wenn Arbeitgeber der Aufforderung zur Nachzahlung nicht nachkommen, wird der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Höhe der Bussen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Höhe der Differenz, die Anzahl der betroffenen Angestellten und die Kooperationsbereitschaft des Arbeitgebers.
Hintergrundinformationen
Die kantonale Arbeitsmarktinspektion kontrolliert in der Regel einen Zeitraum von drei Monaten. Sie gleicht die tatsächlich ausbezahlten Löhne mit den gesetzlichen Mindestanforderungen ab. Die Lohndifferenz ergibt sich aus dem Vergleich des Ist-Werts (effektiv bezahlter Stundenlohn) mit dem Soll-Wert (gesetzlicher Mindestlohn pro Stunde).
Diskussion über die Ursachen der Verstösse
Die Gründe für die Mindestlohnunterschreitungen sind Gegenstand von Diskussionen zwischen den Sozialpartnern. Das WSU erhebt die genauen Ursachen der Verfehlungen nicht. Patrik Felber von der Unia vermutet, dass es sich bei den Verstössen «oft um bewusste oder in Kauf genommene Handlungen von Arbeitgebern handelt, die den Mindestlohn nicht vollständig umsetzen wollen oder administrative Spielräume zu ihren Gunsten nutzen».
Der Arbeitgeberverband Region Basel widerspricht dieser Ansicht. Sprecher Frank Linhart argumentiert, dass die minimalen Abweichungen belegen, dass Arbeitgeber grundsätzlich bestrebt sind, den Mindestlohn einzuhalten. Er vermutet, dass fehlbare Firmen möglicherweise nicht über die aktuelle Höhe des Mindestlohns informiert sind. «Obwohl der Arbeitgeberverband Region Basel seine Mitglieder regelmässig über die Mindestlohnhöhe informiert, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Einzelfällen die Unternehmen noch einen Mindestlohn aus dem Vorjahr zur Anwendung bringen.»
Auswirkungen einer Praxisänderung
Ein weiterer möglicher Grund für die Unterschreitungen könnte eine Praxisänderung der Behörden sein. Der 13. Monatslohn, sofern er einmalig am Jahresende ausbezahlt wird, fliesst nicht mehr in die Berechnung des geschuldeten Stundenlohns ein. Dies bedeutet, dass bei gleichbleibender Jahreslohnsumme der Stundenansatz rechnerisch sinkt.
Die Behörden akzeptieren diese Praxis nicht mehr, obwohl der Arbeitnehmer über das Jahr gesehen gleich viel verdient. Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) begründet dies auf seiner Website damit, dass der Mindestlohn einen «sozialpolitischen Charakter» habe und daher «monatlich erreicht werden» müsse. Betroffene Firmen müssten ihre Buchhaltung theoretisch von 13 auf 12 Monatslöhne umstellen, was einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand darstellt.
Fazit und Ausblick
Die Kontrollen in Basel-Stadt zeigen, dass der Mindestlohn von einem Teil der Unternehmen nicht vollständig eingehalten wird. Während die meisten Verstösse geringfügig sind, verdeutlichen die gravierenden Einzelfälle die Notwendigkeit konsequenter Kontrollen. Die Debatte über die Ursachen der Unterschreitungen und die Auswirkungen administrativer Vorgaben bleibt bestehen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Arbeitnehmer in Basel-Stadt den gesetzlich zustehenden Lohn erhalten, um ein Existenzminimum zu gewährleisten.